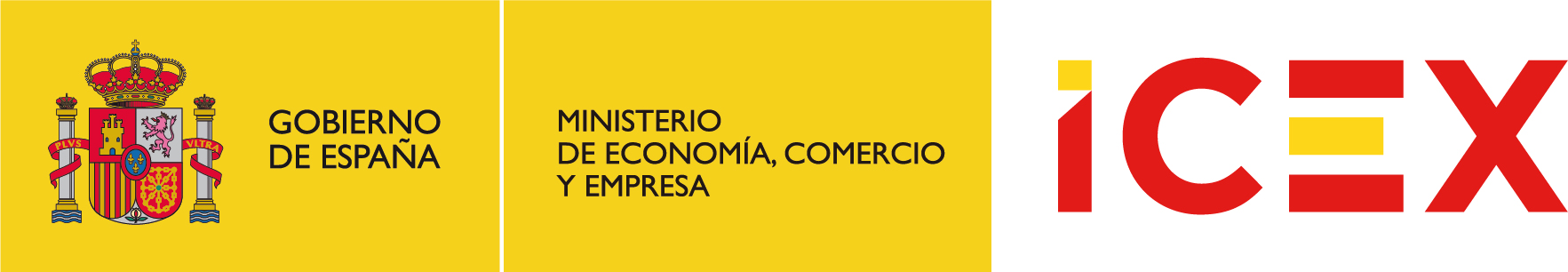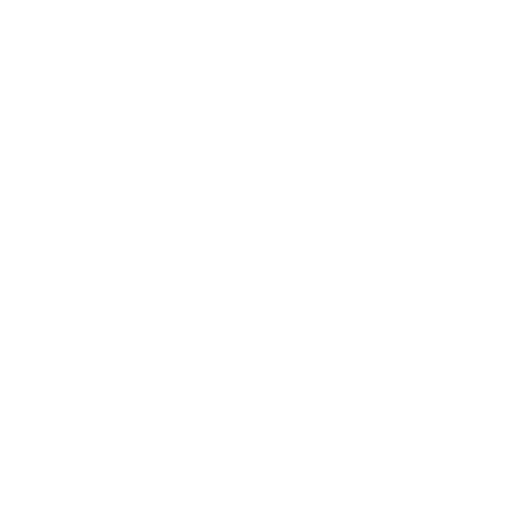Die Geschichte – eigentlich müsste man sagen die Geschichten –, mit der uns die Autorin in die fremde Welt Afghanistans entführt, zieht einen ab der ersten Seite in ihren Bann, sodass man das schmale Bändchen gar nicht mehr aus der Hand legen mag.
Nach der schmerzlichen Trennung von ihrem Lebensgefährten Ulises nimmt die Madrilenin María eine Stelle als Berichterstatterin in Kabul an. Zunächst lebt sie in einer Wohngemeinschaft mit anderen Spaniern, doch dann zieht sie, abgestoßen von der westlichen Arroganz der Mitbewohner und um die Einheimischen mit der als unmoralisch erachteten Lebensform nicht länger zu verstören, in das Haus ihres Dolmetschers Ahmadi. Von dort schickt sie ihre „Zwiebelchroniken“ (so benannt nach den Kleiderschichten, da sie in der Öffentlichkeit eine Burka tragen muss) über Land und Leute an die Redaktion in Spanien. Im Text findet sich eine zur üblichen Praxis des bacha posh, des „falschen Sohnes“, bei der im Falle eines fehlenden Stammhalters eine Tochter auserwählt wird, als Junge zu leben, um dieser alle Freiheiten, wie z.B. eine Ausbildung, zu ermöglichen, und – das ist natürlich der Hauptgrund - um die Familienehre zu retten. Eine weitere mit dem Titel „Fotografien“ beschreibt die Begegnung Marías mit der jungen Kriegerwitwe Samira, die für sie die im Garten vergrabene Kiste mit den Familienfotos (Fotografien sind verboten) und den damit verbundenen Geschichten öffnet.
María wird die zunächst fremde Welt immer vertrauter, hinter der blauen Burka fühlt sie sich zunehmend freier, weil die Blicke der anderen, die Erwartungen, von ihr abfallen. Sie genießt die inkognito Spaziergänge über den Bazar und die Besuche im Hamam mit den anderen Frauen. Das Leben um sie herum ist einfach, arm.
Zu Anfang des Romans begegnet uns Simón, ein Koordinator der Vereinten Nationen, der von Ulises damit beauftragt wird, María ausfindig zu machen und zurückzubringen. Er nimmt Kontakt mit María auf, verfolgt sie. Sie beginnt ein Spiel mit ihm, indem sie auf dem Bazar in der Menge verschwindet und irgendwann wieder auftaucht. Doch eines Tages bleibt sie verschwunden und Simón begibt sich mit dem Einheimischen Mahmud als Führer und Dolmetscher in die Berge, um nach ihr zu suchen. Die Suche nach ihr wird für ihn zur Obsession. Ulisses und sein Auftrag sind zu dem Zeitpunkt längst in den Hintergrund getreten.
Das alles wird nicht chronologisch erzählt, sondern anhand sich fortspinnender oder sich spiegelnder Motive und (Lebens-)Geschichten, die jeweils neue Fenster öffnen. Die Handlung beginnt und endet mit Simóns Angst, der sich schon als kleiner Junge auf dem Schulhof vor den größeren Kerlen fürchtete, und am Ende einsehen muss, dass Marías Gesicht ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen und es keine Erlösung geben wird.
Eingeflochten sind die Geschichten von Mahmud und seinem Cousin Ibrahim, beide Opfer des Krieges. Der Hüne Mahmud wird als Kindersoldat in die Berge des Nordens entführt, wo er, der sehr geschickt im Umgang mit Drachen ist und damit die Helikopter der Russen vom Himmel holen kann, jahrelang kämpft, bis ihn der Schmerz über das Leid der Soldaten zurück in die Stadt treibt. Der Teppichverkäufer Ibrahim, so erfahren wir am Ende des Buches, muss als Kind vor Angst erstarrt mitansehen, wie sein Vater vom Feind wahllos ausgewählt und erschossen und mit dem Kopf nach unten an einem Baum aufgeknüpft wird – ein Trauma, das er verdrängt. Es gibt kurze Reflexionen zu Krieg, Minen und den perversen Kampfstrategien, die Bilder von Butscha drängen sich geradezu auf. Eine Helferin ist Míster Marta, eine europäische Ärztin, die sich als List ein männliches Pseudonym zugelegt hat, um als Frau Kranke und Verwundete behandeln zu dürfen.
Das Grandiose an dem Text ist jedoch die zweite, fantastische oder magische Ebene, auf der mit dem Motiv des Verschwindens gespielt wird. María, die zunächst Gefallen an der Unsichtbarkeit hinter der Burka oder den Dämpfen des Hamam findet, spürt plötzlich, dass ihre Sprache „verwässert“ (deslavazar). Mahmud, der einen kurzen Blick auf die nackte schöne weiße Frau im Hamam erhaschen kann, ist sofort verzaubert, nimmt sie aber bereits als „durchscheinendes Wesen“, als „Entwurf des Begehrens“ wahr (123). Er erläutert, dass die Frauen vor ihrem Verschwinden noch einmal auf besondere Weise strahlen. Seine alte Tante Jana, die das Hamam beaufsichtigt, wird schließlich Zeugin, wie sich María in einem Strudel aus Wasser auflöst und im Ausguss verschwindet. Dieser Prozess wird auch aus der Perspektive Marías beschrieben, für die sich die Welt plötzlich zu verflüssigen scheint. Muhamed wartet Tag für Tag darauf, sie umgeben von einer Aureole als blaues Gespenst wiederzusehen.
Was ist mit María geschehen? Ist sie abgereist? Wurde sie entführt? Getötet? (Realistische Lesart) oder ist sie in eine andere magische Welt entflohen? Wie in einem Kaleidoskop entstehen immer wieder neue Bilder und Projektionsflächen.
Die Autorin Paula Farias, geboren 1968 in Madrid, ist Ärztin und humanitäre Helferin. Sie hat sich bei Greenpeace und Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen Auslandseinsätzen u.a. im Kosovo und in Afghanistan engagiert. Über den Kosovokrieg hat sie 2005 die Geschichte Dejarse llover (dt. Sich nassregnen lassen) geschrieben, die von Fernando León de Aranoa unter dem Titel A perfect day erfolgreich verfilmt wurde. Im vorliegenden Band bringt sie den Leser:innen auf sehr poetische Weise anhand von Einzelschicksalen die raue, kriegsgebeutelte Welt Afghanistans nahe, die dennoch in einen magischen Zauber gehüllt scheint.
Die Beziehungen und Gefühle der Figuren bleiben zwischen Erinnerungen und unerfüllter Sehnsucht ambivalent. Die Titelmetapher der blauen Gespenster bezieht sich auf die blauen Burkas, hinter denen die Frauen „verschwinden“. Sie sind in der Gesellschaft unsichtbar, aber, dem Blick entzogen, eröffnen sich auch Freiräume der Fantasie, denn „auch wenn es nicht immer nachvollziehbar ist, was sich unter einem Schleier abspielt, ist es deshalb nicht weniger wahr“ (136). Paula Farias lenkt den Blick auf ein Land, das in der aktuellen Informationsflut unterzugehen scheint. Gerade das macht das Buch aktuell und wichtig.
Der Stil ist auf weiten Strecken lakonisch, an anderen Stellen ist der Text stark mit Bildern und Emotionen aufgeladen (beispielsweise die Schilderung der Erschießung von Ibrahims Vater) oder ironisch verbrämt. Bestimmte Bilder, wie z.B. die Drachen, die Maria plötzlich umschweben, oder der Traum von einem Regen aus Holzblumen, gehen einem nach der Lektüre nicht mehr aus dem Kopf.
Fazit: Eine klare Empfehlung. Das Buch ist für ein breites Lesepublikum geeignet.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...