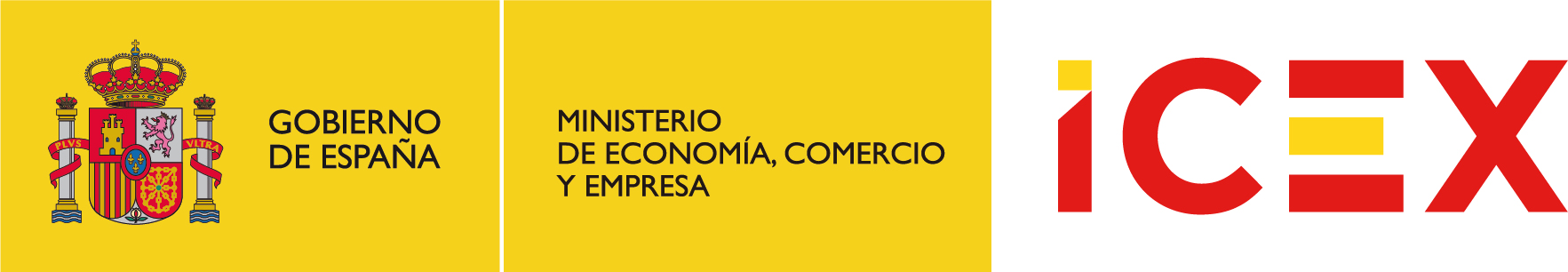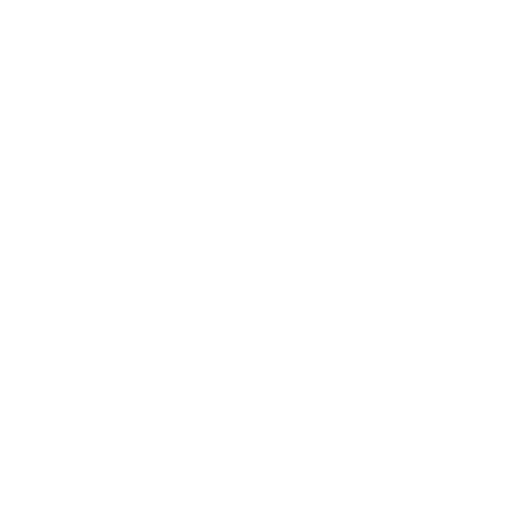Zusammenfassung
Siete maneras de matar a un gato ist ein starkes Stück Literatur über das Leben an den Rändern des Wohlstands. In kargen, schnörkellosen Hauptsätzen führt Matías Néspolo vor, dass Literatur auch berühren kann, wenn sie nicht warmherzig ist. Das Buch wird speziell für ein jüngeres Zielpublikum empfohlen.
Hintergrundinformationen
Siete maneras de matar a un gato ist der bereits 2009 erschienene Debut-Roman des argentinischen Autors Matías Néspolo. Der Roman liegt bereits auf Englisch vor.
Der 1975 geborene Schriftsteller hat Erzählungen, Gedichte und Jugendliteratur veröffentlicht, außerdem arbeitet er als Journalist für mehrere spanischsprachige Tageszeitungen. 2010 bekam Matías Néspolo von der Zeitschrift Granta ein Feature in ihrer Rubrik „Best of Young Spanish-Language Novelists“.
Inhalt
Wer beim Titel „Sieben Arten, eine Katze zu töten“ an eine Metapher denkt, wird gleich auf den ersten Seiten eines Besseren belehrt. Denn hier wird der Leser in die Kunst eingeführt, die titelgebende Katze „auf die gute Weise“ umzubringen – und sie anschließend zuzubereiten. Denn der Protagonist Gringo und sein Freund Chueco haben Hunger.
Der Roman spielt in den heruntergekommenen Vorstadtbezirken von Gran Buenos Aires in den Jahren nach der großen Finanzkrise Argentiniens. Viele von Néspolos Figuren sind jung, haben weder Familie noch finanzielle Ressourcen und erst recht keine Perspektiven. Das tägliche Überleben fordert schon ihre ganze Kraft: Drogen, Bandenkriege, sexuelle Gewalt, Verrat und Straßenschlachten fordern ihren Tribut. Für einen kurzen Augenblick scheint es, als würde sich Gringo ein Ausweg bieten. Er bekommt das Angebot, wegzugehen, ein Handwerk zu lernen, neu anzufangen. Doch die Chance vergeht ungenutzt, war vielleicht nie real. Auch Gringos erste Liebe endet in selten beschriebener Tragik.
Dass diese Fülle an Themen auf wenig mehr als 200 Seiten nicht erdrückend wirkt, liegt daran, dass der Roman szenisch bleibt, kein Schicksal auserzählt wird. Alle Figuren bewegen sich radikal im Jetzt und ihre Geschichten existieren nur so lange, wie Gringo mit ihnen in Berührung kommt. So bleibt auch das Ende weitgehend offen: In einer atmosphärisch wunderbar gelungenen Schilderung der letzten Augenblicke, bevor eine friedliche Demonstration in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit der Polizei umschlägt, wirft Gringo den ersten Stein. Ob der Junge noch steht, wenn sich der Rauch verzogen hat, muss jeder Leser für sich selbst entscheiden.
Sprache/Stil
Néspolo wählt für seine Erzählung über die Ausweglosigkeit aus der Misere eine karge, schnörkellose Sprache, die sich radikal auf die Innensicht des Protagonisten beschränkt. Sprachlich verlässt sich der Text oft auf die elementare Wucht von Hauptsätzen, Adjektive und Beschreibungen sind auf ein Minimum reduziert. Der Wille zur poetischen Formgebung wird nur manchmal in den Endsätzen der kurzen Kapitel deutlich, wenn - immer auf Augenhöhe des Protagonisten - ein kurzer Moment der Einsicht gewährt wird.
Ein wichtiges erzählerisches Mittel ist für Néspolo die wörtliche Rede, die der Autor geschickt dafür nutzt, den Leser mit weiteren Informationen zu Figur und Situation zu versorgen. Durch seine Dialoghaftigkeit gewinnt der Text an Lebendigkeit und Authentizität, zumal das argentinische Spanisch ja reich ist an Interjektionen und Vulgärsprache.
Bewertung
Siete maneras de matar a un gato ist ein gelungenes Beispiel für eine Erzählung, die ein bestimmtes Milieu und einen bestimmten historischen Zeitpunkt portraitiert und es dabei trotzdem schafft, allgemeingültig zu bleiben. Néspolo zeigt seinem Publikum in kurzen, lebendigen Szenen ohne langatmige Charakterstudien, dass sein jugendlicher Protagonist eigentlich ein gutes Herz hat – aber sich Gutmütigkeit aufgrund des ihn umgebenden Elends einfach nicht leisten kann. Das sorgt auch im Europa der 2020er Jahre noch für ein starkes Stück Literatur, das am „Ende der liberalen Weltordnung“ (NZZ, 04.05.2022) durchaus zum Nachdenken einlädt. Obwohl es sich bei dem Roman nicht um Jugendliteratur handelt, wäre eine Vermarktung, die ein jüngeres Publikum anspricht, sicherlich die beste Wahl.
Hinweis auf Übersetzungsmöglichkeiten
Wie schon kurz angerissen, ist der Text im argentinischen Spanisch verfasst, das sich allgemein durch seinen Reichtum an Interjektionen, Flüchen und Schimpfwörtern auszeichnet. Viele dieser Kraftausdrücke sind in Argentinien in die allgemeine Lexik eingegangen und können auf verschiedenen Bedeutungsebenen eingesetzt werden. Im vorliegenden Fall ist die Gossensprache aber zusätzlich inhaltlich motiviert, da sich jugendliche Gauner nirgendwo auf der Welt in Hochsprache unterhalten.
Im Deutschen hingegen wird insgesamt viel weniger geflucht, nicht einmal in Milieu-Studien reihen die Protagonisten Kraftausdruck an Kraftausdruck. In der vorliegenden Sprachenpaarung gibt es insofern einen deutlichen Wahrnehmungsunterschied im Gebrauch von Vulgärsprache.
Der Übersetzer wird sich vor der Problematik sehen, ob und wenn ja, wie er diese Kraftausdrücke übersetzt:
Bei einer Übersetzung in Standardsprache wird zwangsläufig der Großteil der elementaren Sprachkraft des Originals verloren gehen. Eine paraphrasierende Übersetzung in einen deutschen Soziolekt (Jugendsprache, Subkultur) wäre sicherlich die spannendere, wenn auch ungleich anspruchsvollere Alternative.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...