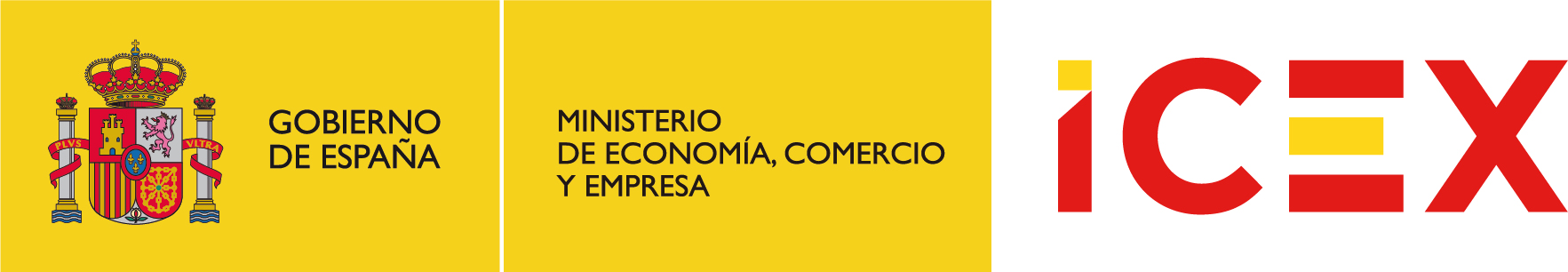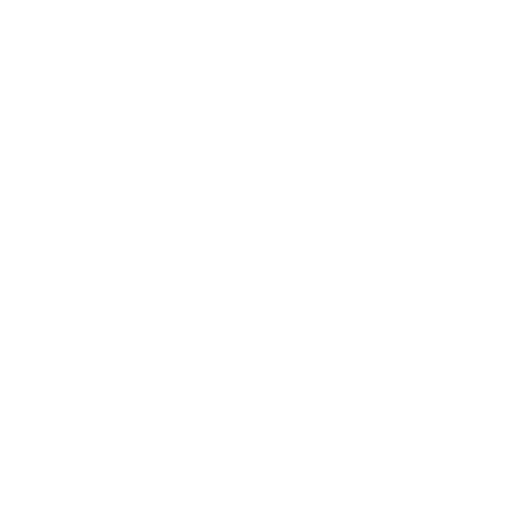Von Kersten Knipp
Barcelona, um 1960: Adrià Ardévol i Bosch übt auf seiner Geige. Wieder und wieder arbeitet er sich durch die Nummer XXII des «Livro dos exercícios da velocidade», eines Übungsbuches, mit dessen Hilfe angehende Virtuosen das Tempo ihres Spiels steigern sollen. Die Übung kombiniert sämtliche Schwierigkeiten des Instruments, weshalb des Trainings nie genug ist. Auch darum nicht, weil Adrià noch eine andere Leidenschaft hat: Historie, insbesondere Ideengeschichte. Und dann auch noch diese: Er liebt die Sprachen, die alten orientalischen wie Chaldäisch, Babylonisch, Samaritanisch, aber auch moderne wie Englisch, Russisch, Französisch, sogar Deutsch. «Vier – Fia. Fünf – Funf»: So stolpern sie vor sich hin, die ersten Gehversuche im Deutschen, die aber bald in die sichere Beherrschung der Sprache münden.
Man kann Jaume Cabrés Roman „Das Schweigen des Sammlers“ auf vielerlei Weise lesen, nicht zuletzt als Roman eines Intellektuellen als junger Mann. Dieser junge Mann, Adrià Ardévol i Bosch, unternimmt ein denkbar großes Abenteuer: sich durch den Dschungel der kulturellen und künstlerischen Angebote einen eigenen Weg zu schlagen, sich über Jahre zu jenem zu machen, der er später sein wird: Eine hoch gebildeter Professor für westliche Ideengeschichte, vielsprachig, belesen – und zudem ein begnadeter Violinist.
Eine ernsthafte intellektuelle Karriere, weit weg von den Angebotshäppchen und dem haltlosen Internet-Geplänkel, das heute zu Zeitverschwendung in nie gekanntem Maß einlädt. Mit derlei Nichtigkeiten haben die Protagonisten dieses Romans nichts zu tun. Sie sind kulturellen Passionen ausgeliefert, die durchaus Leiden hervorrufen. Musik, Sprachen, die Literatur: all dies fordert die Menschen. Manche fordert es absolut. Sie können nicht anders, sind dem Schönen, sind auch der Sinnsuche verfallen, die für sie weit mehr ist als interesseloses Wohlgefallen: Sie sind Passion, ernsthafte Verpflichtung, eine Aufgabe fürs Leben.
Mag sein, dass Das Schweigen des Sammlers auch dieses ist: ein Kommentar zu postmodernen, spätkapitalistischen Identitätsdebatten, die auch in Spanien geführt werden. Was heißt es heute, in Zeiten überbordender digitaler Zerstreuungsmöglichkeiten, eine selbständige Person zu sein? Das Angebot ist riesig, aber auch etwas billig. Es gibt Schmalspuridentitäten, meist leicht vulgäre Versuche, aus der Masse der Anderen herauszuragen – und genau dies, schreibt der Soziologe Vicente Verdú in seinem Essayband El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción, belebt das Geschäft. „Der Kapitalismus hat unser Bedürfnis erkannt, uns der Entfremdung zu widersetzen. Er vernimmt den Stolz jedes einzelnen von uns, sich durch tatoos und piercings herauszuheben. Er bemerkt die Begeisterung, anders, verschieden zu sein.“
Das Problem ist nur: Die ganze Körperarbeit nützt nicht viel. Am Ende haben sich so viele Menschen eine Zeichnung in den Arm oder auf die Hüfte spritzen lassen, dass das tatoo zur Uniform wird. Alle haben eines, und die Kombination mit einem tatoo macht es nicht besser. Das Ganze drückt keine Individualität mehr aus, sondern im Gegenteil, absolute Gegenwartshörigkeit, grenzenlose Verfallenheit an Mode und Zeitgeist. Es ist dies die Situation, die nach all den stürmischen – wahrscheinlich zu stürmischen – Ideen einsetzte, mit denen viele vor einigen Jahren das Projekt Zukunft in Angriff nahmen. Was kam dabei heraus? Am Ende nicht allzu viel. „Wo sind die Leute alle hin?“, lässt Rafael Chirbes in seinem Roman „Los viejos amigos“ einen seiner Protagonisten fragen. Er könne es nicht sagen, entgegnet sein Freund, er wisse nichts mehr über die alten Gefährten. „Weder von den Kommunisten, noch den chicas-chico, noch den Astrologen, noch sonst von all den Leuten, mit denen wir stundenlang darüber diskutierten, was zu tun sei und was nicht, um die Welt zu verändern. All das sind Sternschnuppen, die einen Moment lang leuchteten und dann erloschen.“
So sind sie zerstäubt, die großen, allzu-großen Pläne, und geblieben ist – la crisis, die Wirtschaftskrise, die auch eine Krise der Kultur und der großen Programme ist. „Die Unternehmer verkauften ihre Firmen an ausländische Unternehmen, die sie nur erwarben, um sie auseinanderzunehmen und so die Konkurrenz auszuschalten“, schreibt Eduardo Mendoza in seinem Roman Maurício o las elecciones primarias. „So blieben Tausende Arbeiter auf der Straße, während ihre ehemaligen Arbeitgeber astronomische Summen einsteckten, mit denen sie dann zu spekulieren begannen.“ Das Ende der großen Spekulationsgeschichten kennt man inzwischen.
Was tun, heißt die Frage aller Fragen, doch Überzeugendes fällt niemandem ein. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass die spanische Gegenwartsliteratur auf andere Konzepte setzt. Konzepte, die zwar die Krise nicht lesen können, aber vielleicht eine Ahnung davon vermitteln, was es heißt, sich seine Würde zu bewahren. Denn Krisen gab es viele in Spanien, der Großteil des 20. Jahrhunderts war zumindest bis 1975 für viele Bürger des Landes eine einzige Krise. Und so ist es vielleicht an der Zeit, daran zu erinnern, wie man sich in jenen Jahren durchschlug - und ganz nebenbei die eigene Würde verteidigte.
Indem man zum Beispiel Klavier spielte. Ringo investiert viel, um diese Kunst zu lernen. Doch die Eltern sind arm, selbst für die Verhältnisse des nach dem Bürgerkrieg darbenden Spanien. So ist das begabte Kind gezwungen, das zu ergreifen, was man einen „ordentlichen Beruf“ nennt. Ringo geht bei einem Goldschmied in die Lehre, verliert während der Arbeit mit dem harten Gerät aber einen Finger. Was bleibt, ist die Aura der Musik, der unmöglich gewordene Traum, der nun nur noch vergebliche Verheißung ist. Und trotzdem: es gibt andere Kunstformen. Und eine von ihnen eignet sich nun auch Ringo an. Er schreibt einen ihm zum Transport anvertrauten, dann aber verloren gegangenen Liebesbrief kurzerhand aus eigener Feder neu – und zwar unendlich viel eleganter als das Original. Kalligraphie der Träume heißt Juan Marsés anmutiger Roman, der zwar nicht von einem erfüllten Leben handelt, wohl aber – immerhin – von der Ahnung eines erfüllten Lebens. Denn Kunst, Kino und später dann die Liebe wehen einen Hauch von Erfüllung in das Leben dieses jungen Mannes im Barcelona der 1940er Jahre, einer tristen, depressiven Gesellschaft. Aber: Aus dieser Gesellschaft geht in jenen Jahren ein Künstler des geschriebenen Worts, hinter dem man durchaus Juan Marsé selber vermuten kann.
Und darauf kommt es wohl an – nicht nur, denn die Zustände sind düster, aber eben auch: auf persönliche Anstrengung. „Mehr Liebenswürdigkeit“ empfiehlt Vicente Verdú, „mehr Humor, mehr Mitleid, mehr Empathie, gute Manieren, bessere Kenntnisse, eine größere Neugier; Bildung, um in Kontakt miteinander zu treten, um Triumphe und Niederlagen erleben zu können, um leben und sterben zu können, um Glück zu empfinden, ohne Schuldgefühle zu haben, ... um vielfältig, professionell und individuell handeln zu können.“ Ein vielleicht etwas zu einfaches Programm angesichts der Krise. Aber doch eines, das die persönliche Voraussetzung aller persönlichen Entwicklung ist. Ein trotziges „Jetzt erst recht“.
Worum es geht, hat der Schriftsteller Juan José Millás in seinem Roman „Meine Straße war die Welt“ gezeigt. Auch Millás erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, eines Kindes fast noch. Lieblingsort im Haus der Eltern ist der Keller, von dem aus er das Leben auf der Straße beobachtet. Doch aus der unterirdischen Perspektive verzerren sich die Verhältnisse: Die Lebenden erscheinen als Tote und die Toten als Lebende. Aber handelt es sich wirklich um Gegensätze? Nicht unbedingt, findet der Erzähler, im Gegenteil: Immer mehr sei ihm klar geworden, „dass der Tod nichts weiter war als eine Verschiebung innerhalb des Lebens. Aber was ich sah, das waren vor allem die unsichtbaren Verknüpfungen, die all das einten, und diese Verknüpfungen waren so solide, dass in tiefster Wirklichkeit alles eine Äußerung desselben war.“
Das klingt nur arg esoterisch, aber Millás ist zu sehr Autor, um sich selbst allzu wörtlich zu nehmen. Die vermeintlichen Verschiebungen zwischen Leben und Toten stellen sich als schlichte Sinnestäuschungen heraus, und eines ist klar: Das Leben findet auf der Straße statt. Dorthin zieht es den Dichter mehr und mehr. Der Tod hingegen hat auf dieser Straße ein vorläufiges Marschverbot. Gegen ihn behauptet sich die Hoffnung, selbst und vielleicht gerade in schwierigen Zeiten.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...