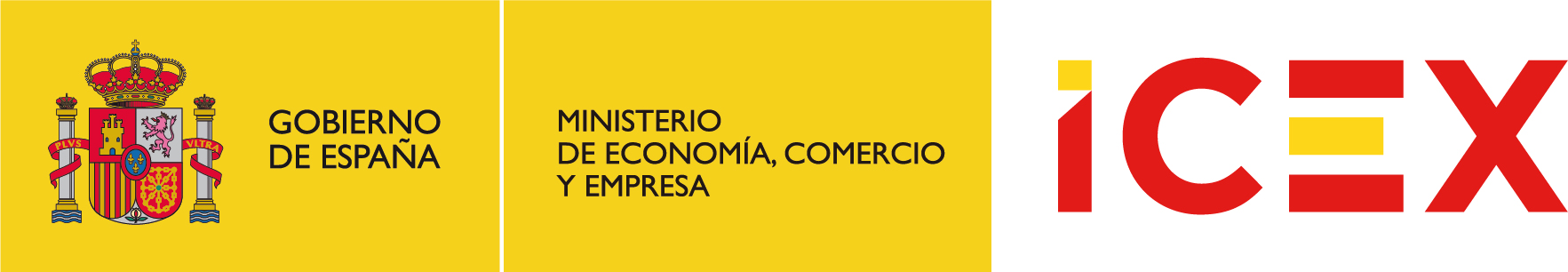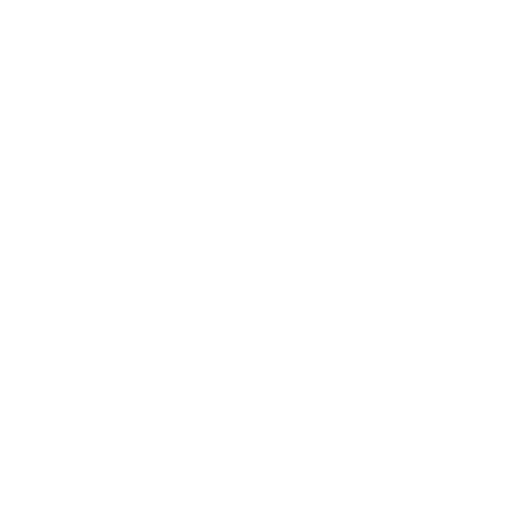Zahlreiche neue spanischsprachige Romane widmen sich Figuren, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. In ganz unterschiedlichen Konstellationen versagen die Figuren bei der Aufgabe, ihr Leben zu organisieren. Doch woran liegt das? Die Autoren geben unterschiedliche Antworten. Ein Essay von Kersten Knipp
Was haben die Eltern schon geleistet? Nichts, im Grunde haben sie alles falsch gemacht, haben die Kinder, die sie in die Welt setzten, auf diese nicht vorbereitet, jedenfalls nicht so, wie sie es hätten tun müssen. Und darum gehören sie vor Gericht, findet Javier, der darum das eigentlich Unvorstellbare ins Auge fasst: die eigenen Eltern zu verklagen. Dafür, dass sie ihm und seiner Schwester eine so weltfremde Erziehung verpasst, ein Lebensgefühl vermittelt haben, das so gar nicht in die Gegenwart passt. Er selbst denkt und empfindet im Stil einer vergangenen Zeit, ist Javier überzeugt. Mit der Gegenwart kann er nicht Schritt halten, er fühlt sich ihr fremd gegenüber, und weil diese Fremdheit auf die Erziehung seiner Eltern zurückgeht, will er sie vor Gericht stellen.
"El Lugar de la espera" heißt der in der Ichform erzählte Roman von Sonia Hernández (*1976), der auf radikal ungeschminkte Art das Lebensgefühl vieler junger Spanier in Zeiten der Krise umreißt: nicht in das Land zu passen, sich nicht eingliedern zu können, ökonomisch, kulturell und sozial ein Außenseiter zu bleiben. Schon der Titel deutet es an: Die Protagonisten befinden sich in einer Art Wartesaal. Sie warten auf das Leben, als Nachfahren von Estragon und Wladimir, den beiden Protagonisten aus Samuel Becketts "Warten auf Godot". Nur dass sie, wie Javier, eine Spur aggressiver sind: "Jetzt will er auch die Lehrer, die Schule, das Ministerium und die Regierung dahinter anprangern", berichtet seine Schwester, die Ich-Erzählerin des Romans.
Javier ist in Hernández' Roman mit seinem Leid nicht allein. Malva war eine erfolgreiche TV-Schauspielerin, bis sie an Panikattacken zu leiden begann. Der Abstieg folgte prompt. Inzwischen arbeitet sie als Kellnerin. Vassily ist Künstler, der aus Javiers Prozess eine Performance machen und dessen Anliegen ins Grundsätzliche heben will. Doch dazu kommt es nicht, wie es überhaupt zu nichts kommt im Leben der Protagonisten. Deren Lebensgefühl hat Hernández in dem vielstimmigen, thematisch lockeren Roman überzeugend eingefangen. Die Stimmen bilden ein Labyrinth von Empfindungen, aus denen sie keinen Ausweg finden. Die Frage ist nur – Hernández lässt sie unbeantwortet: Gibt es überhaupt einen Ausweg? Und wenn ja, wo läge er? Nicht auszuschließen ist, dass die Figuren an sich selbst scheitern: Haben sie, so die im Roman offen gelassene Frage, wirklich alles versucht, sich in der Welt einzurichten? Genauer: Haben sie es auf angemessene Weise versucht?
"El lugar de la espera" ist ein zweideutiger Roman, der sich mit den Protagonisten mal zu identifizieren scheint, mal ihre Haltung kritisiert. Vielleicht ist dieses Schwanken zwischen Annäherung und Distanz aber typisch für eine Zeit, die an alle, die in ihr leben, höchste Anforderungen stellt. Der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett hat vor gut 20 Jahren ein berühmt gewordenes Buch, "Der flexible Mensch" (so der deutsche Titel) geschrieben. Darin schildert er die vielfältigen Ansprüche, die an Menschen in modernen Gesellschaften gestellt werden, und die in der Regel kreative, eigenständige Antworten erfordern. Tradierte Verhaltensweisen reichen nicht mehr, um in der Gesellschaft zu bestehen, muss der Mensch sich etwas einfallen lassen. Für den spanischen Kontext hat der Soziologe Vicente Verdú ähnliche Beobachtungen gemacht. Beim Blick auf einige der jüngsten Romane spanischer und spanischsprachiger Autoren kommen sie unwillkürlich in den Sinn.
So auch bei der Lektüre des jüngsten Romans von Juan Manuel de Prada (*1970), "Lucía en la noche". Der zentrale Protagonist, Alejandro Ballesteros, ist eine höchst eigenwillige Figur: ein Schriftsteller mit einem allzu großen Mangel an Inspiration. "Die Schriftstellerei, voller Unverschämtheiten und Taktlosigkeiten, ließ mich im Stich". Die Engel, so heißt es in dem Roman, meiden jenen, der ihrer so dringend bedarf. Was tun? Ballesteros stürzt sich in das, was man bisweilen "das pralle Leben" nennt: Feste, Empfänge, Reisen, Konferenzen. Kurzum, all das, was ein Schriftstellerleben eben auch ausmacht. Auch – aber eben nicht nur.
Manuel de Prada lässt seinen Protagonisten aussprechen, was immer ihm in den Sinn komme. Das sind teils ernsthafte Reflexionen, teils beachtliche Banalitäten. Lucia heißt die Muse, die er alsbald treffen und rasch auch wieder verlieren wird. Die Suche nach ihr macht einen erheblichen Teil des Romans aus. Entscheidend aber sind die Qualen des Schriftstellers vor dem weißen Blatt: Wie geht er um mit dessen Leere, die auch seine eigene ist? Manuel de Prada findet keine eindeutige Lösung. Er verzichtet ebenso darauf, seine Figur zu kritisieren wie auch darauf, sie zu bedauern. Jeder Job, so kann man es verstehen, hat seine Härten. Wie man sie meistert – eben darauf gibt es keine verbindlichen Antworten. Gefordert ist der flexible Mensch", ausgesetzt der Schwierigkeit, Antworten auch dann geben zu müssen, wenn er keine Antworten hat.
Die Kunst wird zum Spiegel der generell in Unordnung geratenen Verhältnisse.
An denen sind auch die vier weiblichen Protagonistinnen von Inma López Silva (*1978) Roman "Aqueles días en que eramos malas" gescheitert. Ort der Handlung ist ein Gefängnis, in dem vier Frauen einsitzen, die teils an der Gesellschaft, teils an sich selbst gescheitert sind: eine Nonne, eine Prostituierte, eine kolumbianische Drogenschmugglerin, eine auf Abwege gekommene Tänzerin. Hinzu kommt die mit ihnen ins Gespräch verwickelte Gefängnisleiterin. Die Weltflucht der Nonne, die Armut der Kolumbianerin, die geächtete Prostituierte: Wie sich behaupten in einer Welt, die es mit manchen Menschen ganz offenbar von Anfang an nicht gut meint? Deutlich scheint in López Silvas Roman die härtere Gangart der Weltwirtschaft durch, inklusive des Drucks, den sie auf die (in diesem Fall) westlichen Gesellschaften – und damit auch Spanien - ausübt.
Der Roman entwirft ein Porträt der Globalisierung von ihrer düsteren Seite, zeigt, wie sie auf das Leben der Protagonistinnen ihren Schatten wirft und fragt, darin Dostojewski folgend, nach den Bedingungen des Verbrechens: Unter welchen Umständen wird man schuldig. Und wird man juristisch schuldig gesprochen und muss ins Gefängnis: Ist damit über die Verantwortung des Verurteilten alles gesagt? Inma López Silva deutet an, dass das nicht der Fall ist. Verstrickung und Schicksal hängen auf dunkle Weise zusammen – es gibt Biographien, die vom Start weg glücklich sind, bei denen ein Gefängnisaufenthalt von Anfang an zwar nicht unmöglich, aber doch mit einiger Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist. López Silva handelt von Figuren, auf die das Gegenteil zutrifft.
Eine vergleichbarem Unglück verhaftete Gruppe nimmt auch Cristina Morales (*1985) in ihrem Roman "Lectura fácil" in den Blick: vier Frauen in einem Heim für psychisch erkrankte Menschen. Der Roman besticht durch seine verbale Aggressivität, den Wunsch der Erzähler – vielleicht auch der Autorin – sich schon stilistisch nicht in die Konventionen der schönen Rede einzufügen, stattdessen widerspenstig, ja ausfallend zu bleiben. Kräftige Ausdrücke durchziehen den Roman, eine Sprache, die (fast) alles aufgreift, woran ein am höflichen Ton orientierter Leser sich stoßen könnte.
Mit scharfem Blick beschreibt die Autorin die Stadt Barcelona als urbanen Konfliktraum, in dem die unterschiedlichsten Gruppen und Interessen aufeinanderstoßen. Barcelona, das ist die Stadt – auch – der aus dem Gleichgewicht gekommenen Menschen, es ist die Stadt, in der sich herkömmliche Konflikte verdichten, in der Reibungen entstehen, die man vorher von ganz anderen Orten, nämlich denen der spanischen Kolonialgeschichte, kannte. "Die Lebensumstände weißer Frauen wie auch der indigener Frauen ist ein fiktives Refugium, um das zu verdecken, was noch mehr Ängste auslöst – nämlich die weiterhin ungelöste Frage des Ursprungs." Hier taucht er wieder auf, der Ursprung, sei es der geographische, sei es der soziale. Und wieder erscheint er als jener Ort, der ein ganzes Leben bestimmt. Doch die psychiatrische Anstalt als Ort des Einspruchs, als Bühne, von der aus sich der Protest artikuliert? Cristina Morales schafft mit dem Ort der Handlung eine gewagte Konstellation.
Und doch, vielleicht aber bleibt als Lösung irgendwann nur der Wahnsinn, zumindest der kontrollierte Wahn. Diese These probt Horacio Castellanos Mora (*1957) in seinen Aufzeichnungen "Envejece un perro tras los cristales: Cuaderno de Tokio". Castellanos Mora schreibt von einem sechsmonatigen Aufenthalt in Tokio, einer Megastadt, die ihm nicht zuletzt zur Selbsterkundung und –prüfung dient. Besteht man in der Fremde, hält man sich selber aus? "Du bist in diese Stadt gekommen, um deinen Wahn zu beobachten", notiert er. "Dazu, sie zu verstehen, wenn das Glück mit dir ist. Wenn nicht, bleibt nur der Wahn." In kurzen Passagen fängt der Autor das Leben in der Megapolis ein, bemerkt hinter der Uniformität die Vielfalt des urbanen Alltags. Tokio gilt im Westen als Metropole der Konformität – kann es sein, dass diese ein westliches Vorurteil ist? Es könnte sein, findet Castellanos Mora, der hinter den streng geregelten Abläufen der Stadt eine Vielfalt individueller Verhaltensweisen findet. Und doch, ganz wesentlich ist das Buch das augenzwinkernde Werk eines Egotisten (nicht: Egoisten), eines Menschen, der nichts sieht, ohne zugleich auch einen Blick auf sich selbst zu werden, die Stärken, mehr aber noch die Schwächen. "Frage am Morgen: Welcher Teil deines Alltagsglücks hängt davon ab, gelobt zu werden? Antwort: der ganze." Reisen bildet, kann man von Castellanos Mora lernen. Man wird sich zwar auch am anderen Ende der Welt nicht los. Aber mit ein bisschen Ironie gelingt es immerhin, sich selbst zu ertragen.
Sonia Hernández, El Lugar de la espera (Acantilado)
Horacio Castellanos Mora, Envejece un perro tras los cristales: Cuaderno de Tokio seguido de Cuaderno de Iowa (Random House)
Juan Manuel de Prada, Lucía en la noche (Espasa libros)
Inma López Silva, Aqueles días en que eramos malas (Editorial Galixia)
Cristina Morales, Lectura fácil (Narrativas hispánicas)
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...