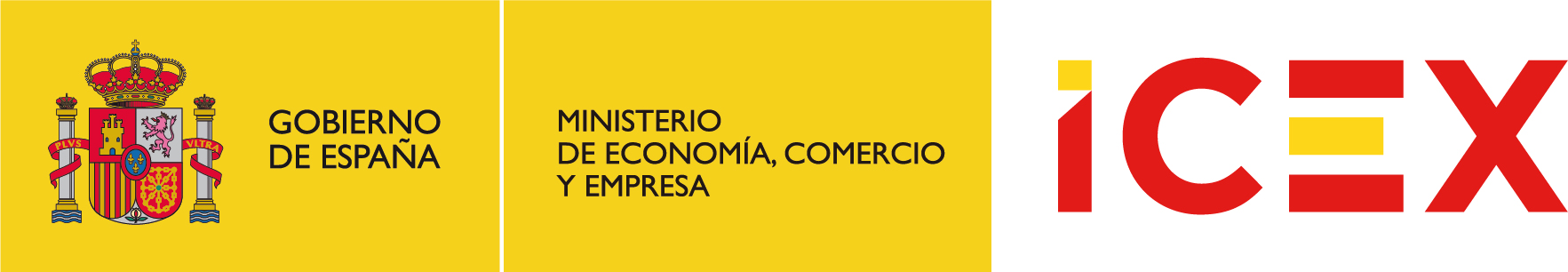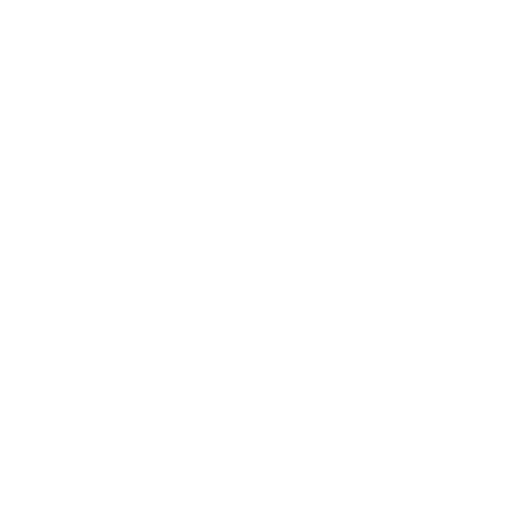Von Marco Thomas Bosshard
Während sich die spanische Literatur nach dem Übergang zur Demokratie als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 1991 im Aufbruch befand und sich anschickte, die internationalen Buchmärkte für sich zu erobern, befindet sich die gegenwärtige spanische Literatur, ein Jahr vor ihrem zweiten Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2022, vielmehr im Umbruch. Viele Autor*innen, die über Jahrzehnte hinweg den spanischen Literaturbetrieb geprägt haben, sind in den vergangenen Jahren gestorben: hochdekorierte Cervantes-Preisträger wie Juan Goytisolo oder Juan Marsé ebenso wie Bestsellerautoren wie Carlos Ruiz Zafón sowie weitere wichtige, auch in Deutschland gelesene Schriftsteller*innen wie Rafael Chirbes, Esther Tusquets, Ana María Matute, Javier Tomeo oder Javier Fernández de Castro.
So gibt im aktuellen, wie überall auf der Welt vom Roman dominerten Literaturbetrieb des Landes – neben Eduardo Mendoza, Jaume Cabré und Enrique Vila-Matas, die schon etwas älter sind – nunmehr eine Gruppe von in den 1950er bzw. frühen 1960er Jahren geborenen Autor*innen den Ton an: Namen wie Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez-Reverte, Almudena Grandes, Bernardo Atxaga, Javier Cercas, Ignacio Martínez de Pisón oder auch Rosa Montero, die dank ihrer Übersetzungen in viele Sprachen ebenfalls bereits seit vielen Jahren etabliert und auch deutschen Leser*innen durchaus ein Begriff sind. Zu ihnen haben sich in den letzten Jahren einige wenige neue Namen derselben Generation gesellt, so etwa der in der Sparte des kommerziellen historischen Romans einschlägige Ildefonso Falcones, dessen Roman Die Kathedrale des Meers 2008 wochenlang die deutschen Bestsellerlisten anführte. Wieder andere haben ihren (auch internationalen) Durchbruch, trotz langer Jahre literarischer Produktion, erst spät geschafft: Allen voran wäre hier der seit den 1980er Jahren in Deutschland lebende Fernando Aramburu zu nennen, dessen anspruchsvoller Roman Patria (2016; dt. 2018) mit über einer halben Million hierzulande verkauften Exemplaren auch in Deutschland zu einem Bestseller wurde – was angesichts des darin aufgegriffenen Themas, des jahrzehntelangen Terrors der ETA im Baskenland, nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Mit dem ebenso heiklen Thema des Spanischen Bürgerkriegs, das spätestens seit der Jahrtausendwende die spanische Prosa dominiert, tut sich die deutsche Leserschaft hingegen ungleich schwerer. Wichtige Werke zu dieser Thematik wie Cercas’ Roman Soldaten von Salamis (2002; im Original Soldados de Salamina, 2001) oder die bis heute in vielen deutschen Schulen gelesene Erzählung des Galiciers Manuel Rivas Die Zunge des Schmetterlings (im Original A língua da borboleta, 1999; auf Deutsch enthalten im Erzählband Die Nacht, in der ich auf Brautschau ging, 2003) haben das Genre der Bürgerkriegsliteratur auch im deutschsprachigen Raum etabliert. Doch halten sich deutsche Verlage zu diesem Thema in den letzten Jahren auffällig zurück – auch weil im Vergleich zu den Verkäufen solcher Bücher in Spanien die Erwartungen deutscher Verlage nur selten erfüllt werden. Ob dies tatsächlich – und ausschließlich – an den darin behandelten Thematiken liegt, darf allerdings bezweifelt werden: Wie eine Auswertung der Verkaufszahlen aller zwischen 2007 und 2018 erschienenen Übersetzungen zweier deutscher Publikumsverlage zeigt, verkaufen sich aus dem Spanischen übersetzte Bücher, ganz unabhängig von ihrem Thema, im Schnitt nur etwa halb so gut wie Bücher aus dem Italienischen oder Französischen. [1]
Sollte sich dieser Befund auch für andere deutsche Verlage bestätigen – und dafür spricht (leider) vieles –, so führt kein Weg an der Feststellung vorbei, dass spanische Autor*innen mit Blick auf ihre Erfolgsaussichten und ihre Wahrnehmung durch die deutsche Leserschaft gegenüber italienischen und französischen Autor*innen (von skandinavischen ganz zu schweigen) grundsätzlich im Nachteil sind. Ausnahmen wie Javier Marías oder Fernando Aramburu bestätigen die Regel – wobei es neben solchen ‚literarischen‘ Bestsellern auch in der unterhaltenden Genreliteratur jenseits von Ruiz Zafón und Falcones durchaus erfolgreiche Titel gibt. Diese bedienen sich internationaler Erfolgsrezepte, die sowohl darin bestehen können, das Setting mit einem spezifisch spanischen Lokalkolorit aufzuladen – siehe Dolores Redondo in ihrer baskischen Baztán-Trilogie – als auch im Gegenteil zu universalisieren, indem nichtspanische Schauplätze gewählt werden: so z.B. bei Félix J. Palma in seiner viktorianischen Science-Fiction-Trilogie, bei María Dueñas und Matilde Asensi in gleich mehreren ihrer Romane oder auch bei Rosa Ribas in ihren Krimis rund um die Frankfurter Kommissarin Cornelia Weber-Tejedor. In der Kinder- und Jugendliteratur haben spanische Autor*innen in Deutschland ebenfalls einen schweren Stand – doch auch hier gibt es Ausnahmen: so z.B. María Isabel Sánchez Vergara mit ihren illustrierten biographischen Büchern über berühmte Frauen der Zeitgeschichte. Ihr Fall ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich der seit den 1970er Jahren um die spanischsprachige Literatur bemühte, hochangesehene Suhrkamp Verlag mit den Übersetzungen gleich mehrerer dieser kurzen Bücher Sánchez Vergaras 2019 zum allerersten Mal überhaupt in das umkämpfte Segment der Kinder- und Jugendbuchliteratur vorwagte.
Welche Perspektiven haben aber, angesichts dieser nicht ganz einfachen Ausgangslage, literarisch ambitionierte jüngere spanische Autor*innen auf dem deutschen Buchmarkt? Die literarischen Verlage scheinen mehr und mehr davon abzurücken, Autor*innen und ihr Gesamtwerk anstatt einzelner Werke zu verlegen, was bei jüngeren, auf dem deutschen Markt noch nicht durchgesetzten Schriftsteller*innen dazu führt, dass nach kommerziell nicht ganz so erfolgreichen ersten oder zweiten Übersetzungen oft keine weiteren Bücher mehr folgen – und zwar unabhängig vom teilweise sehr etablierten Status dieser Autor*innen in Spanien. Von den wichtigen nach 1970 geborenen Autor*innen erscheinen die Romane von Isaac Rosa einigermaßen kontinuierlich, während dies bei Andrés Barba, Ricardo Menéndez Salmón, Espido Freire, Najat El Hachmi oder Miguel Ángel Hernández nicht – oder nicht mehr – der Fall ist. Gleichzeitig fällt auf, wie wenige spanische Autor*innen derselben Generation in den vergangenen fünf Jahren überhaupt neu auf dem deutschen Markt eingeführt worden sind: Die Liste ist mit Namen wie Milena Busquets, Iván Repila, Marina Perezagua und Sara Mesa sehr kurz und wird auch nicht viel länger, wenn man jüngere Autor*innen wie den 1984 geborenen Juan Gómez Bárcena oder gar die Unterhaltungsliteratur (Care Santos, Cristina Campos, Mamen Sánchez) mit dazu nimmt.
Für die internationale Sichtbarmachung der jeweils jüngsten Autor*innengeneration ist die 2010 und nun wieder 2021 von der britischen Literaturzeitschrift Granta veröffentlichte Liste der besten spanischsprachigen Autor*innen unter 35 Jahren nicht unbedeutend. Trotzdem ist es von der Liste zumal auf den deutschen Buchmarkt ein weiter und steiniger Weg, liegt doch von den 2010 dort aufgeführten Autor*innen mit spanischer Nationalität (Andrés Barba, Pablo Gutiérrez, Sònia Hernández, Javier Montes, Elvira Merino und Alberto Olmos) bis heute einzig von Andrés Barba mindestens ein ganzes Buch in deutscher Übersetzung vor. Auf der Granta-Liste 2021 stehen mit Andrea Abreu, David Aliaga, Munir Hachemi, Cristina Morales, Alejandro Morellón und Irene Reyes-Noguerol nun neuerdings sechs spanische Autor*innen. Ins Deutsche übersetzt ist von ihnen bisher noch niemand – auch wenn die Übersetzung je eines Romans von Andrea Abreu und Cristina Morales für 2022 angekündigt ist. Die veröffentlichenden deutschen Verlage scheinen hierbei auf die mediale Aufmerksamkeit zu setzen, die der spanische Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2022 generieren wird. Ob dies auch dazu führt, diese beiden jungen Autorinnen nachhaltig durchzusetzen, wird sich allerdings erst noch zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass der Umbruch in der spanischen Gegenwartsliteratur, katalysiert durch die Buchmesse kommendes Jahr, dennoch ein Aufbruch oder gar Neubeginn werden kann – und das schwindende Interesse deutschen Leser*innen an der spanischen Literatur wieder gesteigert werden kann.
“[1] Vgl. Marco Thomas Bosshard: „Measuring the Consumption of Bibliodiversity and the International Reception of Latin American Literary Production in Translation: Supply and sales of translated books in Germany between 2007 and 2018 (with special attention to book sales of Argentinean and Brazilian authors)“. In: Mabel Moraña/Ana María Gallego Cuiñas (Hrsg.), The World Inside. Latin American Literatures in Global Markets, Leiden/Boston: Brill (in Druck). Auch wenn in dieser Studie der Fokus auf den Absätzen lateinamerikanischer Autor*innen liegt, wurden die Verkaufszahlen der den deutschen Buchmarkt bei Übersetzungen aus dem Spanischen quantitativ noch immer klar dominierenden spanischen Autor*innen mit erhoben.“
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...