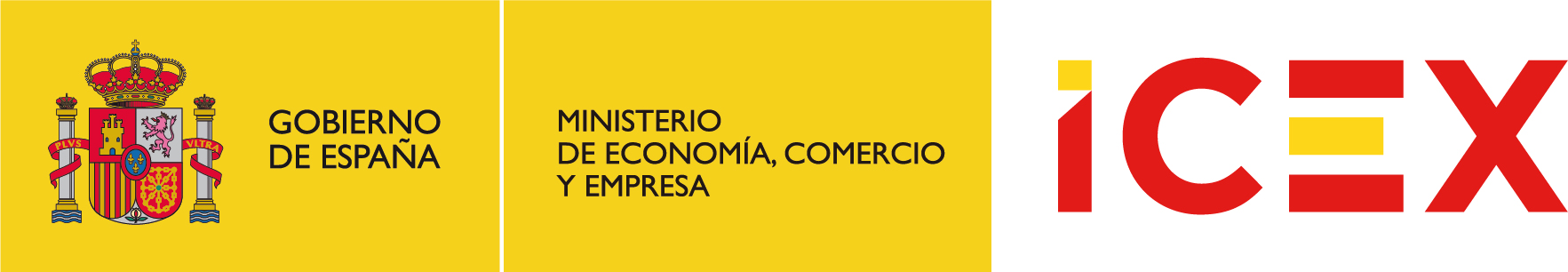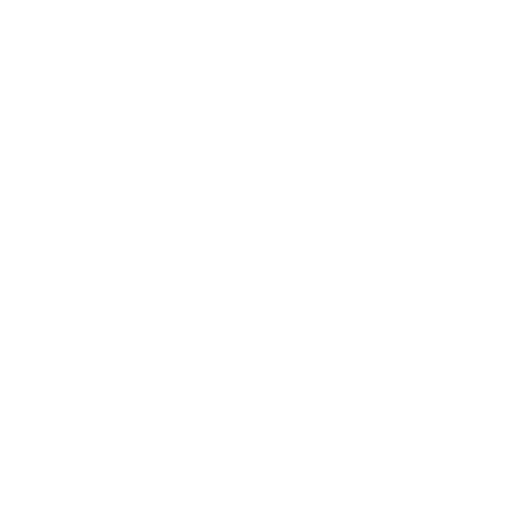Zur aktuellen Blüte der journalistischen Chronik
Unter der Obhut Gabriel García Márquez und im Rahmen der Internationalen Buchmesse fand im Mai 2008 in Bogotá der Encuentro Nuevos Cronistas de Indias statt. Die Begegnung der Neuen Indienchronisten wurde von der Stiftung Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano ins Leben gerufen und verfolgte das Ziel, die Autoren, die Werke und die Tendenzen der journalistischen Chronik zu fördern und bekanntzugeben; eine Gattung, so die Veranstalter, die stellvertretend für einen qualitätsvollen Kulturjournalismus in Lateinamerika ist und die sich besonders eignet, die sozialen Umstände der Länder der Region wahrzunehmen und zu erklären.
Mit dem Titel des Kongresses bezogen sich die Organisatoren ausdrücklich auf die ersten europäischen Chronisten, die über die Entdeckung, Eroberung und Kolonisierung Amerikas berichtet haben. Die Verdienste jene Entdecker, Abenteurer, Soldaten und Missionare im Bereich der lateinamerikanischen Prosa werden heute noch von zahlreichen Intellektuellen anerkannt. Der kürzlich verstorbene mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes hielt zum Beispiel Bernal Díaz del Castillo, einen einfachen Soldaten, der seine Erfahrungen bei den Feldzügen Hernán Cortés in Die wahrhaftige Geschichte der Eroberung Mexikos niederschrieb, für den ersten Romancier seines Landes. Und der peruanische Autor Mario Vargas Llosa behauptet, die Indienchronisten seien die Begründer des Schriftjournalismus auf dem Kontinent; Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Pedro Cieza de León, Pedro Pizarro oder Bernal Díaz del Castillo hätten als Protagonisten oder Zeugen über unmittelbare Ereignisse der „brennenden Aktualität“ berichtet, so wie es heutzutage wahre Reporter oder Auslandskorrespondenten pflegen (Sirenas en el Amazonas, El País, 8.12.1998).
Dass diese Chroniken als die Urtexte sowohl der Literatur als auch des Journalismus Lateinamerikas gelten, liegt in der hybriden Natur der Gattung. Denn auch wenn die Chronisten die Absicht verfolgten, realitätstreu zu berichten, sind ihre Werke durchtränkt von der unbewußten Verschmelzung von Realität und Fiktion; ein logisches Ergebnis der Einstellung, Konzeption und Mentalität mit denen diese Pionierreisenden die überwältigende neue Welt wahrgenommen haben.
Viele Autoren Lateinamerikas sehen sich in der Tradition der Indienchronisten verankert; als allererster Gabriel García Márquez. Bezeichnenderweise begann seine Nobelpreisrede La soledad de América Latina (1982) mit einer Würdigung des Entdeckers Antonio Pigafetta, Autor einer „rigorosen Chronik, die zugleich wie ein Abenteuer der Vorstellungskraft wirkt“. Es fällt hier nicht schwer einen direkten Bezug zum „Magischen Realismus“ zu ziehen, jene literarische Strömung, die angeführt von Gabriel García Márquez, die Literatur Lateinamerikas lange Zeit prägte und ab den siebziger Jahren in Europa so bekannt machte. Bewusst eingesetzt, ist die Mischung aus Wirklichkeit und Phantasie für die Vertreter dieser Gattung, die am besten geeignete Art, die komplexe Realität des Kontinents zu erfassen.
Auch in seiner in Deutschland weniger bekannten Tätigkeit als Journalist hat sich García Márquez von den Chroniken über die Neue Welt inspirieren lassen; Chroniken, die sich wie fesselnde Geschichten lesen und die von der neugierigen Leserschaft in Europa mit zunehmender Faszination aufgenommen wurden. In ihnen fand er zweifelsohne Inspiration um seine, wie er sie selbst nennt, „Märchen, die wahr sind“ zu verfassen. Die Früchte dieser journalistischen Tätigkeit sind Texte wie Bericht eines Schiffbrüchigen, Das Abenteuer des Miguel Littín oder Nachricht von einer Entführung.
Im Oktober des Jahres 1994 verwirklichte Gabriel García Márquez einer seiner Träume: die Gründung im kolumbianischen Cartagena de Indias der Stiftung Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Damit wollte er aufstrebende Autoren unterstützen sowie die Ethik und die narrative Qualität des Journalismus in Lateinamerika vorantreiben. Zunächst veranstaltete er ein Kolloquium über die Pressefreiheit und kurz darauf, unter der Leitung der mexikanischen Journalistin des New Yorker und The New York Review of Books, Alma Guillermoprieto, einen Workshop über die Chronik, an dem junge lateinamerikanische Journalisten teilnahmen. Bis heute gilt dieser Taller de Crónica als die Geburtsstunde der neuen lateinamerikanischen Chronik oder, wenn man so will, die Wiedergeburt der Crónica de Indias. Ein langer Weg, der selbstverständlich über diverse Etappen geführt hat, unter anderem, die kostumbristischen Sittengemälde des 19. Jahrhunderts, die poetisch-philosophisch geprägten Chroniken des Modernismus oder die zumeist politisch engagierten Reportagen, die die „modernen Klassiker“ –García Márquez, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez oder Elena Poniatowska– während der turbulenten sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts verfassten. Ein Weg der natürlich auch nicht frei vom fremden Einfluss verlaufen ist: in erster Linie von Vertretern des nordamerikanischen New Journalism wie Truman Capote, Gay Talese, Thomas Wolf und Norman Mailer, aber auch von europäischen Reportern wie Egon Erwin Kish, Josep Pla, Bruce Chatwin, Ryszard Kapuściński oder Oriana Fallaci.
Das Ergebnis dieser Entwicklung sind journalistische Chroniken und Reportagen, die sich wie Romane lesen; wahre Geschichten, die mit Hilfe literarischer Mittel erzählt werden. Ausgehend von dieser minimalen Begriffserklärung gibt es inzwischen fast so viele Definitionen wie Vertreter. So z.B. ist für den Mexikaner Carlos Monsiváis eine Chronik „die literarische Rekonstruktion von Ereignissen oder Personen; ein journalistisches Genre bei dem nicht die informative Hast, sondern der formelle Aspekt überwiegt“. Für den Peruaner Toño Angulo Danieri handelt es sich um die „inzestuöse Tochter der Geschichte und der Literatur, die älter ist als der Journalismus“. Der Kolumbianer Mario Jursich bringt eine originelle Variante: „eine Chronik ist ein Genre mit einem Fuß in der Literatur und dem anderen beim Notar“. Die umfassendste Definition, die auch die wichtigsten Merkmale einbezieht, bietet der Mexikaner Juan Villoro: Er vergleicht die Chronik mit der komplexen Struktur eines Schnabeltieres, einem Wesen, das die narrative Fähigkeit des Romans aufweist, die Fakten der Reportage, die Spannung einer Kurzgeschichte, die Dialoge des Interviews, die szenische Montage eines Theaterstücks, die Argumentation des Essays und die Ich-Perspektive einer Autobiographie.
Schon Ende der neunziger Jahren verbreitet sich die Gattung rasch durch den gesamten Kontinent, zunächst anhand zahlreicher neugegründeter Chronik-Zeitschriften – Gatopardo (Kolumbien, Argentinien, Mexiko), Etiqueta negra (Perú), El Malpensante und Soho (Kolumbien), lamujerdemivida (Argentina), Pie izquierdo, (Bolivia), Marcapasos (Venezuela), Letras Libres (Mexiko) oder The Clinic (Chile)– aber auch über die allgemeine Presse, die ein wachsendes Interesse zeigt, die Chroniken in die Wochenendbeilagen aufzunehmen. Die Verlagsindustrie erkennt ebenfalls das Verkaufspotential und lässt gesammelte Chroniken in Form von Monographien und Anthologien drucken, die hohe Auflagen erreichen. Es werden auch Preise ausgeschrieben, unzählige Seminare und Workshops veranstaltet, und natürlich expandiert die Chronik im 21. Jahrhundert über das Internet, in Blogs oder virtuellen Zeitschriften.
Inzwischen hat die lateinamerikanische Chronik den alten Kontinent erreicht, was in diesem Jahr die Publikation zweier Anthologien in spanischen Verlagen belegt: Antología de crónica latinoamericana actual (Darío Jaramillo Agudelo, Hrsg., Alfaguara, Madrid) und Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (Jorge Carrión, Hrsg., Anagrama, Barcelona). Für den spanischen Leser bieten sie Gelegenheit, einige der wichtigsten Vertreter der Gattung kennenzulernen: Leila Guerriero und Martín Caparrós (Argentinien), Pedro Lemebel und Juan Pablo Meneses (Chile), Alberto Salcedo (Kolumbien), Juan Villoro und Fabrizio Mejía (Mexiko), Julio Villanueva Chang (Perú), Edgardo Rodríguez Juliá (Puerto Rico)... . Sie gewähren auch einen Einblick in die unendliche Fülle von Themen, die Gegenstand einer Chronik sein können: Portraits von Mafiabossen, Politikern, Fußballstars, Popidolen und berühmten Schriftstellern, aber auch Lebensgeschichten anonymer Helden und einfacher –oft bizarrer– Leute, Milieustudien von Stadtvierteln oder Straßenmärkten, Reiseberichte in ferngelegenen Orten und Krisengebieten, Schilderungen der Jugendgewalt, Prostitution und Migration, Berichte über Naturkatastrophen, Skizzen volkstümlicher Mythen und moderner Bräuche oder Trends... . Kein Gegenstand ist der Chronik fern; man beobachtet allerdings die Tendenz, sich kritisch mit der Gewalt Lateinamerikas auseinanderzusetzen –in Mexiko gibt es inzwischen die Untergattung Narcocrónicas– sowie, vor allem in den neuesten Chroniken, eine besondere Vorliebe für skurrile Ereignisse und extravagante Protagonisten.
Die Veröffentlichung dieser Anthologien wirft die Frage auf, wie es in Spanien um die Chronik steht. Den Erfolg der Chronik in Lateinamerika hat man in erster Linie auf die Förderung des FNPI und seiner Galionsfigur, García Márquez, zurückgeführt; man hat auch argumentiert, dass es sich bei der Chronik um eine Gattung handelt, die besonders in schwierigen Zeiten, krisengerüttelten Regionen und wandelnden Gesellschaften gedeiht. Demzufolge wäre es nicht verwunderlich, wenn wir in nächster Zeit in Spanien –in ganz Europa–einen Aufbruch der Chronik erleben würden. Erste Anzeichen sind schon da: Es gibt mehrere Verlage, die die Chronik in ihre Kataloge aufgenommen haben ––Libros del KO, Errata Naturae, Capitán Swing, Libros del Asteroide, Libros de la Catarata oder Debate¬¬– und einige spanische Journalisten wie Guillem Martínez, Jordi Costa, Alfonso Armada oder Enric González haben sich auch einen Namen als Chronisten gemacht.
In Lateinamerika hält die Blüte der Chronik weiterhin an. Gerade in diesen Tagen –während des 10. und 12. Oktobers– findet in Mexiko die Fortsetzung des ersten Encuentro Nuevos Cronistas de Indias statt. Niemand wagt es offen von einem neuen Boom zu reden –der Begriff ist zu negativ geprägt; deswegen bevorzugt zum Beispiel der Journalist Javier Rodríguez Marcos, von einer „kontrollierten Explosion der lateinamerikanischen Chronik“ zu sprechen–, jedoch ist die Hoffnung groß, dass durch diese Gattung, das Interesse an der lateinamerikanischen Literatur in Europa wieder geweckt wird. Nicht zu unrecht behauptet Darío Jaramillo in der Einführung seiner Anthologie: „Die journalistische Chronik bietet heutzutage die bestgeschriebene und spannendste Prosa Lateinamerikas“. Und wie der Titel der Anthologie von Jorge Carrión suggeriert – Besser als Fiktion – scheint die „Magie der Realität“ nach fünfzig Jahren den „Magischen Realismus“ zurückgedrängt zu haben. Man braucht in Lateinamerika heute keine Geschichten mehr erfinden, man muss sie nur suchen.
Francisco Uzcanga Meinecke
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...