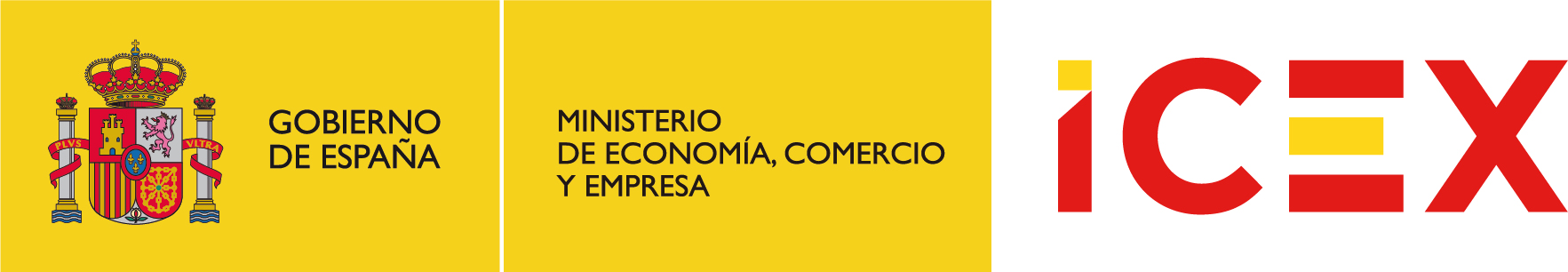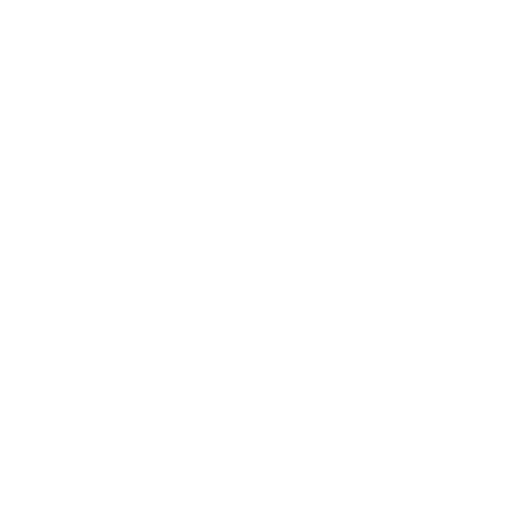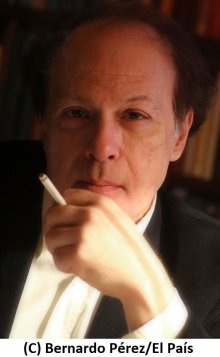
von Michi Strausfeld
Die Nachricht vom unerwarteten Tod von Javier Marias hat die literarische Welt in Deutschland erschüttert. Radiosender berichteten, alle großen Zeitungen brachten ausführliche Würdigungen, so als hätten sie die vorbereiteten Artikel zur Verleihung des Nobelpreises – denn damit haben alle gerechnet – jetzt umschreiben müssen.
Seit der Publikation von „Mein Herz so weiß“ 1996 und der vom Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki geleiteten Fernsehsendung „Literarisches Quartett“ mit einhelligem, überschwänglichem Lob – „ein geniales Werk“ - aller Teilnehmer war Marias Bestsellerautor, ein literarisches Schwergewicht, der weltweit wichtigste Schriftsteller seines Landes. Der Roman eroberte Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste, etwas kaum Vorstellbares für ein literarisch ambitioniertes Werk. Wie war es möglich, dass ein so anspruchsvoller Titel Millionen deutsche Leser in Bann schlug? Was machte den Verfasser zum „Meister des literarischen Krimis“?
Viele Kritiker haben nach Erklärungen gesucht, immer wieder wurde der Stil, bald als „Marias-Sound“ apostrophiert, mit seiner soghaften Kraft genannt: Man könne den verführerischen Eingangssätzen einfach nicht widerstehen. Der Romancier untersucht die hauchdünne Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit, die Zwischentöne, gibt filigrane Andeutungen und liebt lange Abschweifungen, deren Bedeutung sich oft erst viel später erschließt. Gerne beschreibt er Situationen, deren Konturen zwischen Licht und Schatten changieren, achtet dabei auf das präzis gewählte Wort und versucht, seine Musikalität einzufangen. Seinen Lesern bietet er folgenden Hinweis an: Man möge seinen männlichen Ich-Erzählern nicht blind vertrauen, denn ihr Gedächtnis sei letztlich trügerisch und unzuverlässig, wie dies auch bei ihm und fast allen Menschen der Fall sei. Aber mit seinen mäandernden Überlegungen über das, was vielleicht geschah oder nicht geschah, zieht er uns in das fein gesponnene Netz der Vermutungen und Möglichkeiten – und wir folgen ihm gerne.
Über den Inhalt seiner Romane bemerkte er, dass er universelle Themen suche. Daher entlehnte er vermutlich auch sieben Romantitel den Dramen Shakespeares. Desgleichen sagte er einmal: „Was ich meinem Leser anbiete, kommt aus der eigenen Erfahrung und der Phantasie, aber alles geht durch den Filter der Literatur. Das ist das Wichtigste“.
Der Erfolg von Marias setzte sich ungebrochen fort mit „Morgen in der Schlacht denk an mich“ (1998) und „Schwarzer Rücken der Zeit“ (2000). Ältere Titel wurden neu aufgelegt, auch seine Erzählungen und Fußballgeschichten erschienen. Marias war der weltweit beliebteste und berühmteste Autor Spaniens.
Eine Vielzahl einfühlsamer Essays gibt Auskunft über seine literarischen Vorbilder. Neben Shakespeare stehen Cervantes und Sterne, beide Meister der Abschweifungen – letzteren hat er auch übersetzt. Aus dem 20. Jahrhundert nannte er Proust, Henry James, Faulkner, Nabokov und Juan Benet, den bewunderten Freund und Lehrmeister, dem er im Roman „So fängt das Schlimme an“ eine Hommage erweist. Freunde und Familie spielten immer eine wichtige Rolle in seinem Werk, vor allem das Schicksal seines Vaters, des Philosophen Julián Marías, der von Franco nach einer Denunziation, einer Lüge, Berufsverbot erhielt – die Familie musste emigrieren. Die Trilogie „Dein Gesicht morgen“ weist viele Bezüge zu seinem Schicksal auf.
Die allgemeine Begeisterung schwand ein wenig mit diesen drei Romanen (2004-2009), die viele Kritiker jedoch für sein Hauptwerk halten. Nur die Fangemeinde folgte ihrem Autor unbeirrt weiter. Mit dem Roman „Die sterblich Verliebten“ (2012) und einem Verlagswechsel begann ein neuer Siegeszug: wieder schwärmten die Feuilletons, die Buchhändler und die Leser, und Javier Marias unternahm zum ersten Mal seit vielen Jahren eine kleine Lesereise. Überrascht war er von der großen Zuneigung, die ihm überall erwiesen wurde und von der Geduld, mit der die Leser in der langen Schlange warteten, um sich ein Buch widmen zu lassen.
Der erste andeutungsreiche und Fragen aufwerfende Satz war wieder faszinierend: „Das letzte Mal sah ich Miguel Desvern oder Deverne, als ihn auch seine Frau zum letzten Mal sah, was eigentlich seltsam, ja ungerecht ist, denn sie war seine Frau und ich eine Unbekannte, die nie ein Wort mit ihm gewechselt hatte“. Seine Verlegerin Pilar Reyes schrieb in einem Artikel: Wenn Javier den ersten Satz hatte, gab es einen Roman. Erstmals verwendete der Autor eine weibliche Erzählstimme – nach zehn bzw. dreizehn Romanen , wenn man die Trilogie einzeln zählt. Thema sind Verliebtheit und Straflosigkeit, und wie immer gibt der Autor eine Fülle moralischer Überlegungen, die zum Mit- und Nachdenken einladen. Das empfand er durchaus als Herausforderung, hatte er doch immer erklärt, er halte sich für unfähig, diese Perspektive - zuvor in einer einzige Erzählung probiert – in einem langen Text durchzuhalten. Natürlich ist ihm dies als souveräner Beherrscher der Romankunst gelungen.
2015 reiste Marías noch einmal nach Deutschland und hielt die Eröffnungsrede des Berliner Literaturfestivals. Er erzählte von seiner Familie und gab Hinweise auf das eigene Schaffen: „Manchmal, ob in der Literatur oder im Leben, weiß man nicht, was Teil einer Geschichte ist, bis diese Geschichte sich selbst fortschreibt, abgeschlossen und vollendet ist. Meine Schriften sind voll von Episoden, Anekdoten, Bildern und Sätzen, die scheinbar keine bestimmte oder entscheidende Funktion im Ganzen haben. Sie verdanken sich, könnte man sagen, der Laune oder dem Zufall, und so ist es meist auch, wenn sie zum ersten Mal im Text erscheinen. Später jedoch tauchen sie erneut auf und erhalten einen Sinn oder einen andren Sinn, und am Ende sind sie nicht so anekdotisch oder episodisch, dem Zufall oder der Laune geschuldet, wie es den Anschein hatte: Sie werden zu einem grundlegenden Teil der Geschichte. Wie ich schon oft gesagt habe, pflege ich mit dem Kompass, nicht mit einer Landkarte zu schreiben, das heißt, wenn ich die gesamte Geschichte, die ich erzählen will, schon im Voraus kennen würde, sie bereits vollständig im Kopf hätte, bevor ich mich ans Schreiben mache, würde ich mir höchstwahrscheinlich gar nicht mehr die Mühe machen, sie festzuhalten. Es käme mir wie eine Schreibübung vor, ich würde mich langweilen.“
Bei diesem Besuch stellt er den damals letzten Roman vor, „So fängt das Schlimme an“, in dem er die Folgen einer Lüge für eine zuvor glückliche Ehe schildert, die Täuschung des Partners, die dieser nie verzeihen kann. All dies geschieht vor dem Hintergrund der transición, also der Zeit des Übergangs von Diktatur zu Demokratie in Spanien. Seine Romane, die um Beziehungen, um Liebe und Ehe, um Lügen und Verrat kreisen, spielen meist in Madrid und enthalten sehr konkrete Hinweise auf das politische und gesellschaftliche Geschehen – andere haben Oxford als geographisches Zentrum, wenn es Kriminal- und Spionagegeschichten sind.
Das politische Engagement des Autors, seine Überzeugungen und Kritiken hielt er seit mehr als zwanzig Jahren in seiner Sonntagskolumne der Tageszeitung El País fest – gesammelt ergeben sie ein aufschlussreiches Bild der Veränderungen im Land. Es sind präzise recherchierte Artikel über Nationalismus und Korruption, Politik und Justiz, Misswirtschaft und Sprachverzerrungen - vor allem aber behandelte er die vielfältigen Gefahren, die unseren Demokratien drohen. Dezidiert weigerte er sich, einen staatlichen Preis zu erhalten, denn er wollte seine absolute Unabhängigkeit wahren.
Das Werk von Marías ist überaus umfangreich: Sechzehn Romane, Erzähl- und Essaybände, herausragende Übersetzungen oder die Bände seiner Chroniken, das ergibt –zigtausende Seiten. Die Romane wurden in 46 Sprachen übersetzt und 59 Ländern publiziert, die Gesamtauflage beträgt mehrere Millionen. Desgleichen leitete er den elitären Kleinverlag seines Königreich Redonda, einer unbewohnten Antilleninsel, die er vom befreundeten Autor John Gawsworth geerbt hatte. Jedes Jahr publizierte er einige schmale, vergessene Kleinode, die er oft selbst übersetzte und verlieh auch einen bescheiden dotierten Preis.
Marias ist ein Schriftsteller, dessen umfangreiches Werk kaum einzufangen ist. Sein Freund und Kollege Eduardo Mendoza hielt nach seinem Tod fest: „Er schrieb das beste Spanisch im Land, und niemand hat die Frauen so gut verstanden wie er“ - ob mit den männlichen oder einer weiblichen Erzählstimme. Immer erkundete er – mäandernd - die verstreuten Gedankengänge, die oft bizarren Träume, die nagenden Zweifel, komplexen Vergangenheiten und widersprüchlichen Verhaltensweisen seiner Figuren – so als sei er der Proust unserer Zeit.
Das Diptychon „Berta Isla“ (2019) und jetzt, posthum, „Tomás Nevinson“ (2022) zeigen den Autor als grandiosen Romancier, als Meister der erzählenden Prosa. Wiederum handelt es sich um eine Liebes- und eine Spionagegeschichte vor franquistischem Hintergrund. Hier die jeweils ersten Sätze als Einladung, diese beiden Romane zu lesen, die Javier Marias auf der Höhe seiner Kunst zeigen:
„Es gab eine Zeit, da war sie sich nicht sicher, ob ihr Mann ihr Mann war, wie man auch im Dämmerschlaf nicht weiß, ob man denkt oder träumt, ob man seinen Geist noch lenkt oder die Erschöpfung in die Irre führt.“
„Ich wurde nach alter Schule erzogen und hätte nie gedacht, dass man mir eines Tages auftragen würde, eine Frau umzubringen.“
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...