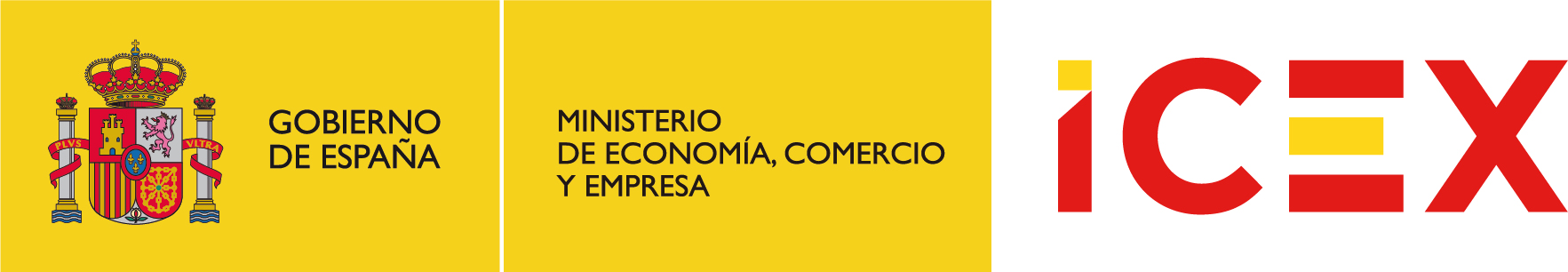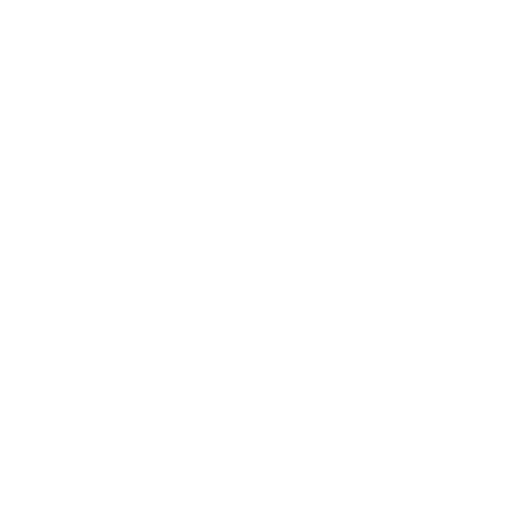Das Tageslicht flutet durch lange, helle Vorhänge in den Salon. Kachelbeläge in Grün und Rostrot strahlen angenehm Kühle vom Boden her ab, noch heute eine Wohltat an Hitzetagen. Auf einer Kommode steht Tafelgeschirr, über einen Rundtisch legt sich ein Spitzendeckchen, in der Vorhalle fällt der Blick auf zwei Schaukelstühle. Das Szenario mutet so an, als könnten die Besitzer gleich zurückkehren – doch das werden sie nicht. Die Huerta de San Vicente, ein typisch andalusisches Landhaus, an das sich die Stadtausläufer Granadas längst herangeschoben haben, ist museal erstarrt, das Standbild einer Epoche. 1926 richtete sich hier die Familie des Federico García Lorca (1898-1936) ein, dessen bildreiche Gedichte untrennbarer Bestandteil von Spaniens Literaturgeschichte sind, dessen Theaterstücke wie “Bernarda Albas Haus” und “Bluthochzeit” noch heute weltweit gespielt werden. Hinter den Mauern des kalkweißen Anwesens fand García Lorca in den heißen Sommern Andalusiens ein Refugium, umgeben vom Land, vom Grün. Hier griff er zum Tintenfüller, schrieb Theaterstücke oder zumindest Teile davon, verfasste Oden, kämpfte gegen Schreibblockaden und Stimmungsschwankungen, malte, spielte auf dem Klavier, genoss die Zeit im Kreis seiner Familie und alberte gelegentlich derart herum, dass "ich mich meines Alters schäme", wie er in einem Brief bekannte.
Das Tageslicht flutet durch lange, helle Vorhänge in den Salon. Kachelbeläge in Grün und Rostrot strahlen angenehm Kühle vom Boden her ab, noch heute eine Wohltat an Hitzetagen. Auf einer Kommode steht Tafelgeschirr, über einen Rundtisch legt sich ein Spitzendeckchen, in der Vorhalle fällt der Blick auf zwei Schaukelstühle. Das Szenario mutet so an, als könnten die Besitzer gleich zurückkehren – doch das werden sie nicht. Die Huerta de San Vicente, ein typisch andalusisches Landhaus, an das sich die Stadtausläufer Granadas längst herangeschoben haben, ist museal erstarrt, das Standbild einer Epoche. 1926 richtete sich hier die Familie des Federico García Lorca (1898-1936) ein, dessen bildreiche Gedichte untrennbarer Bestandteil von Spaniens Literaturgeschichte sind, dessen Theaterstücke wie “Bernarda Albas Haus” und “Bluthochzeit” noch heute weltweit gespielt werden. Hinter den Mauern des kalkweißen Anwesens fand García Lorca in den heißen Sommern Andalusiens ein Refugium, umgeben vom Land, vom Grün. Hier griff er zum Tintenfüller, schrieb Theaterstücke oder zumindest Teile davon, verfasste Oden, kämpfte gegen Schreibblockaden und Stimmungsschwankungen, malte, spielte auf dem Klavier, genoss die Zeit im Kreis seiner Familie und alberte gelegentlich derart herum, dass "ich mich meines Alters schäme", wie er in einem Brief bekannte.
 Die Huerta de San Vicente zählt zu Spaniens eindrucksvollsten Casas-Museo, jenen Museumshäusern, die ihre Pforten für jedermann öffnen und es erlauben, sich den Spuren von bekannten Dichtern und Denkern auf ganz besondere, fast intime Art zu nähern. Hier taucht man als Besucher ein in die Lebens- und Wirkungsstätten, lässt die Blicke über das schweifen, was die Literaten inspiriert haben mag, ihren Charakter und ihre Entwicklung prägte, was sie an Umfeld umgab. Natur und Licht waren wichtige Komponenten im Werk Federico García Lorcas, der 1927 in der Huerta an Ana María Dalí, die Schwester des surrealistischen Bürgerschrecks Salvador, schrieb: “Hier geht es mir gut, das Haus ist groß und von Wasser umgeben.” Im Jahr zuvor hatte eine kleine Bestandsaufnahme an seinen Dichterkollegen Jorge Guillén gelautet: "Es gibt soviel Jasmin im Garten, dass wir morgens alle im Haus einen geradezu lyrischen Kopfschmerz haben." Den Erinnerungen von Federicos Schwester Isabel zufolge kehrte in der Huerta de San Vicente selten Stille ein, so dass der Bruder die nächtlichen Stunden zur Arbeit bei geöffneter Balkontür nutzte. Dies mag erklären, warum Federico auf einem im Landgut hängenden Porträt, das ihn im gelben Bademantel zeigt, nicht so ganz ausgeschlafen wirkt ...
Die Huerta de San Vicente zählt zu Spaniens eindrucksvollsten Casas-Museo, jenen Museumshäusern, die ihre Pforten für jedermann öffnen und es erlauben, sich den Spuren von bekannten Dichtern und Denkern auf ganz besondere, fast intime Art zu nähern. Hier taucht man als Besucher ein in die Lebens- und Wirkungsstätten, lässt die Blicke über das schweifen, was die Literaten inspiriert haben mag, ihren Charakter und ihre Entwicklung prägte, was sie an Umfeld umgab. Natur und Licht waren wichtige Komponenten im Werk Federico García Lorcas, der 1927 in der Huerta an Ana María Dalí, die Schwester des surrealistischen Bürgerschrecks Salvador, schrieb: “Hier geht es mir gut, das Haus ist groß und von Wasser umgeben.” Im Jahr zuvor hatte eine kleine Bestandsaufnahme an seinen Dichterkollegen Jorge Guillén gelautet: "Es gibt soviel Jasmin im Garten, dass wir morgens alle im Haus einen geradezu lyrischen Kopfschmerz haben." Den Erinnerungen von Federicos Schwester Isabel zufolge kehrte in der Huerta de San Vicente selten Stille ein, so dass der Bruder die nächtlichen Stunden zur Arbeit bei geöffneter Balkontür nutzte. Dies mag erklären, warum Federico auf einem im Landgut hängenden Porträt, das ihn im gelben Bademantel zeigt, nicht so ganz ausgeschlafen wirkt ... Die Teilnahme an Führungen durch die Huerta de San Vicente ist obligatorisch. Nach Stationen des Grüppchens im Entree, in der Küche mit ihren Tellern und Kupferschalen, dem Speise- und dem Klavierraum geht es treppaufwärts in den ersten Stock in Federicos Zimmer. An der Wand hängt ein Plakat seiner Theatertruppe “La Barraca”, der rot-blau-schwarz gemusterte Kachelboden trägt sein schlichtes Bett, seinen Schreibtisch aus Nussbaumholz. Ob die Tintenflecken in den ausziehbaren Schublädchen des Schreibtisches wirklich noch von Federico persönlich stammen? Fest steht, dass García Lorca Mitte Juli des tragischen ersten Bürgerkriegsjahrs 1936 aus Madrid in Granada eintraf, ein letztes Mal die Huerta de San Vicente aufsuchte und sie aus Furcht vor Falangistentrupps am 9. August verließ. Eine Woche danch wurde er verhaftet, kurz darauf bei Granada feige erschossen.
Die Teilnahme an Führungen durch die Huerta de San Vicente ist obligatorisch. Nach Stationen des Grüppchens im Entree, in der Küche mit ihren Tellern und Kupferschalen, dem Speise- und dem Klavierraum geht es treppaufwärts in den ersten Stock in Federicos Zimmer. An der Wand hängt ein Plakat seiner Theatertruppe “La Barraca”, der rot-blau-schwarz gemusterte Kachelboden trägt sein schlichtes Bett, seinen Schreibtisch aus Nussbaumholz. Ob die Tintenflecken in den ausziehbaren Schublädchen des Schreibtisches wirklich noch von Federico persönlich stammen? Fest steht, dass García Lorca Mitte Juli des tragischen ersten Bürgerkriegsjahrs 1936 aus Madrid in Granada eintraf, ein letztes Mal die Huerta de San Vicente aufsuchte und sie aus Furcht vor Falangistentrupps am 9. August verließ. Eine Woche danch wurde er verhaftet, kurz darauf bei Granada feige erschossen.
Die Lebenswurzeln des Federico García Lorca liegen in Fuente Vaqueros, knapp 20 Kilometer nordwestlich von Granada. Hier ist sein Geburtshaus ebenfalls als Casa-Museo hergerichtet, hier kommt der Gang durch die Räumlichkeiten und den Innenhof einer kleinen Zeitreise ins Andalusien des ausgehenden 19. Jahrhunderts gleich. Ganz anders aufgezogen – mit Schautafeln, Vitrinen, Fotos, Kunstwerken – ist jenes Haus im andalusischen Städtchen El Puerto de Santa María, in dem der Dichter Rafael Alberti (1902-1999) seine Jugendjahre verlebte. In seiner frühen Schaffensepoche gehörte Alberti, ebenso wie García Lorca, zum Kreis der Poeten der “Generación del 27"; gegen Ende des Bürgerkriegs sah er sich gezwungen, Spanien dauerhaft zu verlassen. Die Worte nach der Rückkehr in sein Land, 1977, nach knapp vier Jahrzehnten im Exil und gut eineinhalb Jahre nach Diktator Francos Tod, sind legendär: “Fort ging ich mit geballter Faust, nun komme ich mit der geöffneten Hand als Zeichen der Versöhnung zwischen allen Spaniern zurück.” Seiner Heimat El Puerto de Santa María setzte Alberti mit den Memoiren “Der Verlorene Hain” ein literarisches Denkmal, dem sich entnehmen lässt, dass er die Unterrichtsstunden in der Jesuitenschule eigenmächtig durch Strandaufenthalte im Adamskostüm ersetzte und die Kindheit für ihn “ein Kaputt-Werfen aller Straßenlaternen am Hafen” bedeutete. Nichts geblieben ist im Wohnhaus des einstigen Hafenbengels vom Orangenbaum in der Mitte noch vom Kohlenkeller, in dem der kleine Rafael seine Strafen absaß und Ängste ausstand. Das Museum der Stiftung in der Calle Santo Domingo zeigt Alberti hingegen auch als Maler – und damit in weniger bekannten Facetten.
Die Reise zu weiteren lohnenden Dichterhäusern führt kreuz und quer durchs Land und gibt Gelegenheit, Kulturrouten abseits ausgetretener Pfade zusammenzustellen: weiter in Andalusien nach Moguer ins Casa-Museo von Literaturnobelpreisträger Juan Ramón Jiménez (1881-1958; "Platero und ich"), in Galicien nach Padrón ins Casa-Museo Rosalía de Castro (1837-1885; “An den Ufern des Sar”), in Valencia hinter den Strand Malvarrosa ins Casa-Museo Vicente Blasco Ibañéz (1867-1928; “Sumpffieber”, “Blutige Arena”). Im Herzen Madrids geht es ins Casa-Museo des literarisch wie hormonell hochproduktiven Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635), auf den rund 1500 Theaterstücke und über ein Kinderdutzend von diversen Frauen zurückgehen sollen.
Die architektonisch so unterschiedlich gestalteten Häuser sind eine, die persönlichen Gegenstände und Angedenken eine andere Sache. Ob die Schreibmaschine des Juan Ramón Jiménez oder die Brille des Vicente Blasco Ibañéz. Im hauseigenen Oratorium soll Lope de Vega nach seiner Weihe zum Priester täglich eine Messe abgehalten haben, auf dem Sterbebett der Rosalía de Castro liegt stets eine frische Blume.
Was Spaniens besuchbare Häuser der Dichter und Denker eint, zu denen alleine in Galicien zwei weitere von Emilia Pardo Bazán (1851-1921; La Coruña) und Nobelpreisträger Camilo José Cela (1916-2002; Padrón) zählen: Jedes für sich bewahrt ein Vermächtnis, jedes gleicht einem geöffneten Buch, jedes rückt die jeweilige Persönlichkeit in ein ganz besonderes Licht. Was im Übrigen nicht einzig für Literaten gilt. Die Casas-Museo des Komponisten Manuel de Falla (1876-1946) in Granada, des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) im Park Güell in Barcelona und eines Jahrhundertkünstlers wie Salvador Dalí (1904-1989) im katalonischen Küstenort Port Lligat sind gleichermaßen sehenswert.
Von Andreas Drouve
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...