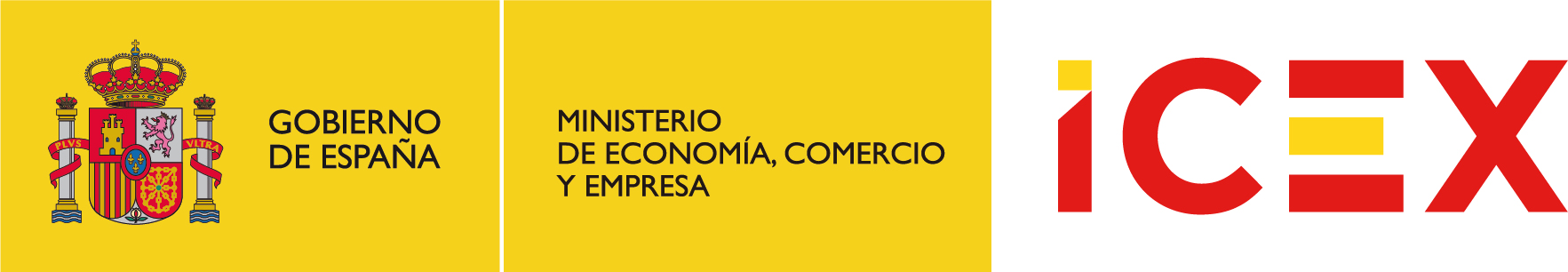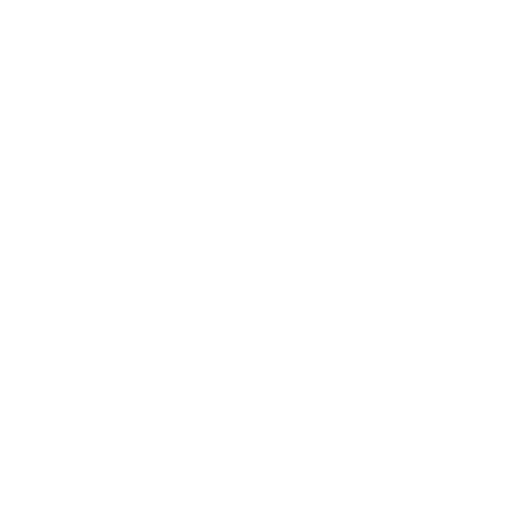Da steht er, der alte Mann. Die schmalen Hände über der Brust gekreuzt, den dünnen Hals straff nach oben gedrückt. Den schmalen Kopf bedeckt eine Generalsmütze, die Augen versteckt eine dunkle,
leicht tränenförmige Brille. Nase, Mund und Ohren sind die einzig freien Gesichtsmerkmale. Der Mann ist bekannt in Spanien, jeder kennt ihn. Sein Name: Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo einer der letzten europäischen Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Das eigentlich Irritierende aber ist: General Franco ist nicht tot. Er lebt, denn er wird künstlich konserviert. Die Figur steht im Kühlschrank eines amerikanischen Brauseherstellers.
"Always Franco" hat der spanische Künstler Eugenio Merino sein Werk genannt. Es soll die Spanier auf den nach Merinos Einschätzung allzu zögerlichen Abschied des Landes vom Erbe des Gewaltherrschers erinnern. Eine gewagte These. Doch als wollte sie diese bestätigen, hängte ihm die "Fundación Francisco Franco", die „Stiftung Francisco Franco“, gleich eine Klage a
n den Hals: Er habe das Andenken an das 1975 verstorbene Staatsoberhaupt beleidigt. Darum solle er eine Entschädigung von 18.000 Euro zahlen. Die Klage wurde abgewiesen – vorerst. Doch die Franco-Stiftung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Der Fall zeigt es: Die Gegenwart ist immer auch ein Kampf um die Deutung der Vergangenheit. Vor allem die jüngste Vergangenheit kommt nicht zur Ruhe, wie auch die lange Zeit geführten Diskussionen um die Exhumierung von Opfern des Franco-Regimes zeigte – allen voran die des in einem Wald bei Granada bestatteten Dichters Federico García Lorca.
Die spanische Geschichte ist umkämpft, ein Umstand, den längst auch die spanische Geschichtswissenschaft beschäftigt. Fernando García de Cortázar, einer der bekanntesten spanischen Historiker, hat vor einiger Zeit ein viel beachtetes Buch vorgelegt: „Los mitos de la Historia de España“. Darin nimmt er sich die gesamte spanische Geschichte, vom Mittelalter bis zur Gegenwart vor, um sie auf ihre teils bis heute aktuellen Mythen abzuklopfen. Das Ergebnis: Keine Epoche, die nicht ihre historischen Legenden gepflegt hätte. Der Grund liegt auf der Hand: „Die Mythen“, schreibt García de Cortázar, „sind Produkte der Nostalgie, Schöpfungen gegen den Absolutismus der Wirklichkeit. ... Der Schlüssel zu diesem Universum sind nicht nur Manipulation und emotionale Entrückung, sondern auch Vergessen und Amnesie.“
Welche Energien ein allzu inniges Verhältnis zur Vergangenheit freisetzt, weiß in Spanien jedes Kind. Denn eine der anmutigsten, freundlichsten und auch berühmtesten Figuren der spanischen Literatur hat ihr ganzes Leben dem Ruhm der Vergangenheit gewidmet, oder besser: dem, was sie für diese Vergangenheit hielt: Don Quijote de la Mancha. Er lebte ganz in der phantastischen Welt seiner Vorfahren, deren Taten er in den damals kursierenden Ritterbüchern bewunderte. Wie es ihm erging, ist bekannt: „Die Phantasie füllte sich ihm mit allem an, was er in den Büchern las, so mit Verzauberungen wie mit Kämpfen, Waffengängen, Herausforderungen, Wunden, süßem Gekose, Liebschaften, Seestürmen, und unmöglichen Narreteien. Und so fest setzte es sich ihm in den Kopf, jener Wust hirnverrückter Erdichtungen, die er las, sei die volle Wahrheit, dass es für ihn keine zweifellosere Geschichte auf Erden gab.“
Die spanische Literatur der Gegenwart nähert sich der Geschichte auf zweifache Weise. Einige Autoren greifen ihre Mythen und großen Erzählungen auf, suchen sie zu entzaubern, hinter den Mythen die Realität zum Vorschein zu bringen. Fast immer wählen sie dazu eine ganz bestimmte Perspektive: nämlich die alltäglicher Personen, von Menschen, die die Geschichte zwar auch gestalteten, vor allem aber zu deren Opfer wurden. Und die Diskussion um Eugenio Merinos Skulptur „Always Franco“ deutet es an: Im Mittelpunkt sämtlicher historischer Debatten in Spanien steht weiterhin jenes Großereignis, das die spanische Geschichte des 20. Jahrhunderts prägte wie kein anderes: der Bürgerkrieg und die sich daran anschließende Franco-Diktatur.
Diese Epoche ist seit langem zentraler Bestandteil der spanischen Literatur. Die frühen Autoren sind rasch genannt: Max Aub, Ramón J. Sender, Luis Cernuda und Miguel Delibes um nur ein paar zu nennen. Mehr als Autoren historischer Romane sind sie freilich Chronisten ihrer Zeit, Zeugen politischer Umwälzungen von ungeheurer Wucht.
Die jüngeren Autoren haben den Bürgerkrieg selbst nicht mehr miterlebt, die Regierungszeit Francos oft aber sehr wohl noch. Dennoch nähern sie sich ihr meist über Menschen einer älteren Generation, die sie als Zeitzeugen auftreten lassen. „Ich konnte“, notiert etwa die Erzählerin von Rafael Chirbes´ Roman Die schöne Schrift, „den Neid auf jene nicht unterdrücken, die gleich am Anfang gegangen sind. Weil ich durchgehalten habe, bin ich im Kampf müde geworden, und habe erfahren müssen, dass die ganze Anstrengung umsonst war. Jetzt warte ich.“
Chirbes pflegt eine karge, zurückhaltende Sprache – und steht damit im Gegensatz zu einer neueren Richtung Romane, die die Franco-Zeit in großen, ausgreifenden Epen schildern, nicht selten aufgebaut nach den Regeln des Thrillers. Javier Cercas ist zu nennen, der in Soldados de Salamina den Bürgerkrieg aus der Perspektive der Nachgeborenen schildert – und darin das Leben Rafael Sánchez Mazas ´entfaltet, eines franquistischen Intellektuellen, der trotz aller Bildung nichts Verwerfliches darin sahen, das Land in den Krieg und dann die Diktatur zu stürzen.
Wie dachten die Intellektuellen, wie dachte man überhaupt unter dem Druck des Krieges? Der 1947 geborene Autor Jaume Cabré hat sich diese Frage in seinem Roman Stimmen des Flusses gestellt – und sie in einen ebenso packenden wie erhellenden Text verpackt, dessen rasenden Spannung ganz nebenbei auch dieses illustriert: für Zwischentöne und Zweifel blieb meist wenig Zeit. Wollte man überleben, musste man seine Zweifel hintanstellen. Und das hieß auch: Man war gezwungen, den Gegner zu töten. Nicht nur die Franquisten, auch die Republikaner wurden schuldig. Beide sahen sich vor Entscheidungen gestellt, die ihnen nur die Wahl zwischen zweierlei Unrecht ließ. So stellt es auch Antonio Muñoz-Molina in seinem großen Epos Die Nacht der Erinnerungen dar. Auch dieser Roman nimmt die Zwischentöne in den Blick, greift die Nöte beider Seiten auf, die Verwicklungen, Zufälle und Bedingungen, unter denen Menschen schuldig werden. Almudena Grandes, Carlos Ruiz Zafón, Andrés Trapiello, um nur ein paar zu nennen: Sie alle nähern sich der Franco-Zeit auf komplexe, vielschichtige Weise.
Doch die fiktionale Ausdeutung der spanischen Geschichte kennt auch einen anderen Weg. Diesen gegen die Autoren meist, wenn es sich um Darstellungen weiter zurück reichender Epochen handelt. Anders als die Ära Franco lasten diese früheren Zeiten aber nicht mehr auf der Gegenwart - ein Umstand, der sich in der Art der Darstellung deutlich bemerkbar macht. Fast alle Romane, die sich Ereignissen vor der Franco-Zeit widmen, sind vor allem eines: Unterhaltung. Erstaunlich ist das nicht: Die Zeiten liegen zu weit zurück, als dass sie noch von ideologischer Relevanz wären. Die frühe Moderne und alles, was vor ihr liegt, gehört literarisch meist in den Bereich der leichten Muse - und damit nicht selten auch zum umkämpften Feld der literarischen Bestseller.
Bei Autoren und Lesern gleichermaßen beliebt ist die Zeit "Katholischen Könige", in deren Regierungszeit 1492 nach 700 Jahren die Vertreibung der letzten arabischen Königreiche, aber auch die erste Entdeckungsfahrt des Kolumbus fiel. Beide Ereignisse lassen 1492 zu einem Schwellenjahr werden, über das Spanien in die Moderne trat. Welcher Preis für diesen Eintritt zu zahlen war, zeigt María Pilar Queralt del Hierro, eine studierte Historikerin, in ihrem Roman Las damas del rey. Die genannten Damen, das sind Isabel und María, Töchter der Katholischen Könige, die historisch bislang aber im Schatten ihrer beiden bekannteren Schwestern Juana la Loca und Caralina de Aragón, standen. Doch ebenso wie diese wurden auch Isabel und María ihres Lebens nicht froh. Als Faustpfand der politischen Ambitionen ihrer Eltern haben sie sich deren Entscheidungen zu beugen, auch und vor allem in Fragen von Liebe und Ehe: Strategische Allianzen müssen geschmiedet werden - und kein festerer Bindemittel gibt es dafür als die Eheschließung. Und so haben sich Isabel und María zu fügen, gehen jene Bindungen ein, aus denen dann das Imperium Karls V entsteht – jenes "Heilige Römische Reich", dessen Herrscher nach Kräften versuchte, den darin verbundenen Staaten den Gedanken auszureden versuchte, jemals wieder Krieg gegeneinander zu führen.
Anhand von - historischen – Briefen wie imaginierten Dialogen erzählt María Pilar Queralt die politische und vor allem private Vorgeschichte dieses Reiches. Wie wiederum das Leben der Mutter von Isabel und María verlief, das zeigt Cristina Hernando, eigentlich eine ausgebildete Psychologin, in ihrem Roman Isabel la Católica. Grandeza, Carácter y Poder. So einfach wie der Titel ist auch die Sprache des Romans – und dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - vermag er den Lesern eine Vorstellung vom Leben der Herrscherin zu geben.
Vom multikulturellen zugleich freilich imperialen Spanien erzählt Rosa López Casero in La pasión de Balboa. Vasco Nuñez de Balboa, eine der bekanntesten Gestalten der frühen spanischen Kolonialgeschichte, führte ein ausgesprochen abenteuerliches Leben. Vom Schweinezüchter in Haiti brachte er es bis zum Führer jener Expedition, die für das spanische Königreiche das heutige Panama entdeckte – hinreichend Stoff also für López Casero die ihn nach den Regeln des Genres verarbeitet, Handlunsgsstränge aus Liebe, Abenteuer, Politik nicht allzu tiefgehend, aber anschaulich miteinander vermischt.
Der Liebe in Zeiten des Kolonialismus hat sich Elvira Méndez gewidmet. In El corazón del océanoerzählt sie das Schicksal 80 junger Frauen, die 1550 nach Lateinamerika aufbrachen, um dort spanische Konquistadoren zu heiraten. Denn die sich zwar unendlichen Landmassen, aber eben auch einer sehr begrenzten Damenwahl gegenüber. Doch der Aufbruch in die Neue Welt ist traditionell gefährlich, und so sehen sich die Frauen bereits während der Überfahrt großen Herausforderungen gegenüber: Piratenüberfelle, Pest, Stürme – das klassische Programm des Seeromans, das nach Ankunft der Passagierinnen adäquate Fortsetzung findet: die Begegnung mit den Eroberern, den unterworfenen Indianern, die Mühen und Gefahren des kolonialen Alltags, und über allem natürlich: die Liebe.
Die spanische Geschichte ist voller historischer Dramen. Und alle werden sie vom historischen Romane der Gegenwart aufgegriffen. La pasión de la reina, von María Pilar Queralt, greift das Leben von María Cristina de Habsburgo an der Seite Alfons XII auf. Pilar Queralt beschreibt das Leben einer Frau an der Schwelle zur politischen Moderne, jenen Jahrzehnten des mittleren 19. Jahrhunderts, in denen das Gedankengut der Aufklärung sich bis in die Politik fortsetzt – und darin auch jene Tendenzen spiegelt, die sich auch in den Kolonien längst verbreitet haben. El sueño de las Antillas hat Carmen Santos ihren Roman über das koloniale Kuba des 19. Jahrhundert genannt, dessen Wechselfälle sie anhand des Schicksals einer jungen Spanierin erzählt, die 1858 in die Neue Welt aufbricht. Auch dieser Roman ist ein Mix aus historischen Fakten und bewährter Elemente des sentimentalen und Abenteuerromans. Politik greift er auf, allerdings in sorgsam dosierten Maß. Es kommt auf Bildung an, mehr aber noch auf Unterhaltung. Damit entspricht sie ganz der Logik ihrer Zeit: In Zeiten der Krise haben die Spanier genug mit ihrer Gegenwart zu tun. Da möge sich bitte wenigstens die Vergangenheit in angenehmem Licht zeigen.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...