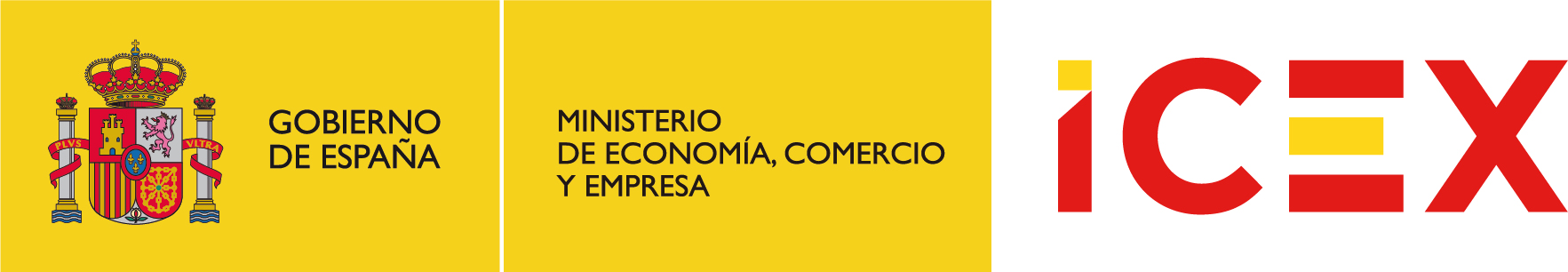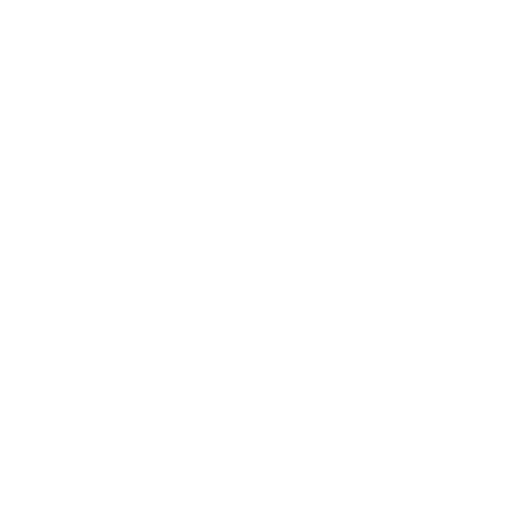Fort zu gehen lag nahe in jenen Zeiten. „Abajo la inteligencia“, „Nieder mit der Intelligenz“, brüllte General Milán Astray, der spanische Führer der Fremdenlegion 1936 in der Universität Salamanca. Nieder mit der Intelligenz, jedenfalls dann, wenn sie sich, wie der damalige Rektor der Universität, Miguel de Unamuno, öffentlich gegen die Ideologie der revoltierenden Faschisten wandten und deren Verherrlichung des Opfertods in Frage stellten. Nieder mit der Intelligenz also. Oder weg mit ihr. Jagt sie fort. Was folgte, war ein Exodus der Intelligenz: Antonio Machado, Pedro Salinas, Max Aub, Ramón J. Sender, Pablo Picasso, Luis Buñuel … Man sollte die Namensliste gar nicht beginnen, denn vollständig wäre sie nie, und sie täte all denen Unrecht, die nicht in ihr erschienen. Jedenfalls erlitt Spanien seit Beginn des Bürgerkriegs einen gewaltigen intellektuellen Aderlass. Das Ausland wurde zur neuen Heimat, das Exil ermöglichte das Weiterleben, künstlerisch und oft genug auch schlicht physisch. Und im Exil wächst, gelegentlich zumindest, auch die Wut. „Tierra ingrata“, beginnt Juan Goytisolo seinen Roman Rückforderung des Conde Don Julián, „undankbare Erde“, deren unbeständiges Klima ihm Symbol der politischen Verhältnisse geworden ist, hervorgebracht von einer „launenhaften Diktatur, voller unabsehbarer Launen: Strömungen, Tiefs, Stürme, überraschende Ruhezeiten, die kein Meteorologe anzukündigen wagen würde“. In kurzen, brutal auseinander gerissenen Sätzen zeichnet Juan Goytisolo 1970 das Bild der alten Heimat. Und wenn die These zutrifft, dass besondere Zeiten einen besonderen, einen neuen Stil prägen, dann dürfte sie in seinem Werk einen eindrucksvollen Beweis finden.
Gut möglich, dass dieser Stil heute ein wenig leichter geworden ist, weniger harsch und aufgeregt. Der 1953 in Chile geborene Roberto Bolaño hat ebenfalls lange Jahre im – vorzugsweise spanischen – Exil verbracht. Er floh vor den Schergen Pinochets, dessen Herrschaft er als junger Mann zu verhindern suchte. „Venceremos“ – einfältige Parolen tönten durch die Region, ließen ihn von Freiheit und Sozialismus träumen, besser noch von Freiheit im Sozialismus, von der Abschaffung des Kapitals und anderer Menschheitsgeißeln, von politischer Erlösung nach dem Tod der Diktatoren. Für Ziele wie diese traten Bolaño und seine Generationsgenossen den Gang aufs Schlachtfeld an – und auf ihnen liegen sie bis heute: „Ganz Lateinamerika ist übersät mit den Knochen jener vergessenen Jugend.“
Seither kann er Literatur nicht mehr anders als engagiert verstehen, bekennt er in seiner Autobiographie Exil im Niemandsland. Doch Exil, was bedeutet das heute? Bolaño selbst hat eine vergleichsweise nüchterne Auffassung vom erzwungenen Leben in der Fremde: „Noch im schlimmsten Fall ist es besser, ins Exil zu gehen als ins Exil gehen zu wollen und es nicht zu können. (. . .) Bestenfalls ist das Exil eine literarische Option. Ähnlich der Option, sich dem Schreiben zu widmen.“
Mag sein, dass ein solch lakonischer Stil durchaus seinen Zweck hat, dass er hilft, das Exil zu verarbeiten. Vielleicht kann man aber auch sagen, dass heute jeder im Exil lebt – zumindest aber in einer Welt, die fremd, bedrohlich, unheimlich geworden ist. Das zumindest legt eine Reihe von Romanen jüngerer Autoren nahe. In ihren Romanen öffnen sich die Grenzen oder werden unterlaufen, die Städte werden bunter, das Leben in ihnen aber auch schwieriger. Man weiß nicht mehr, mit wem man es zu tun hat. Und das gefällt längst nicht allen. Abgesoffen heißt der kurze, ausschließlich in Dialogform gehaltene Roman des 1954 geborenen Autors Carlos Eugenio López, der zu den schwärzesten, sarkastischsten und scharfsinnigsten Texten der spanischen Gegenwartsliteratur gerechnet werden kann. Der Roman entfaltet die Stimmen zweier Auftragsmörder, die Woche für Woche im spanischen Norden einen Maghrebiner entführen, in einer Badewanne ertränken und anschließend in die Meerenge von Gibraltar werfen, wo die Polizei die Leichen dann finden wird. Sinn der Aktion: die Migranten davor zu warnen, weiterhin nach Spanien zu drängen. Denn Spanien, so die Argumentation der Mörder, ist spanisch. Die Nordafrikaner, finden sie, haben ihr eigenes Land. Und dort sollen sie bleiben.
Der Druck steigt, besonders in den unteren Segmenten der Gesellschaft. Wie man in einem der Zentren der kolumbianischen Gewalt, in Medellín, lebt, davon berichtet Jorge Franco in seinem Roman Rosario Tijeras. Er handelt von einer ungerührt zuschlagenden Auftragsmörderin, die sich durcharbeitet von Opfer zu Opfer, um am Ende schließlich selbst an der Gewalt zugrunde zu gehen. Rosario, so kann man den Roman zusammenfassen, kam zur Welt, ermordete eine beachtliche Zahl von Menschen und ging in jungen Jahren selbst zugrunde. Ein Lebensgefühl, wie man es nicht nur in Kolumbien kennt. „Sie sterben sowieso, dann ist es besser, wenn es schnell geht und sie aufhören, die Lebenden zu nerven“, raunt ein Kollege Rosarios am Nordrand des Kontinents, in Mexiko. Er hat seinen Auftritt in Guillermo Fadanellis Roman Das andere Gesicht Rock Hudsons, der eine nicht minder drastisch-brutale Welt vorführt.
Gehetzte Atemlosigkeit, die geistige Gefangenschaft im Hier und Jetzt – das ist der Stoff, aus dem lateinamerikanische Autoren ihre erzählerischen Rhythmen formen. Kurze Sätze, zerlegt durch zahllose Kommas, ein vorwärts drängender Satzbau. Besonders hart ist das Leben an der Grenze Mexikos zu den USA, einer riesigen Sonderwirtschaftszone, die ganz eigene Produkte hervorbringt: „Industriespionage und Giftmüll, Religionen und Kulte, von der Kirche des gekreuzigten Außerirdischen bis hin zum komischen Vampir. Dazu Organhandel, Waffenschmuggel und Mietkiller, und natürlich die ehrwürdigsten von allen: Fluchthilfe, Drogenhandel und Prostitution im ganz großen Stil.“ So stellt sich das nördliche Mexiko aus der Sicht von Gabriel Trujillo Muñoz in seinem Roman Tijuana Blues dar, einem Erzähler mit ganz besonders finsterem Humor.
Nicht ganz so arg, aber durchaus auch kriminell geht es in Spanien zu. Mit Krematorium hat Rafael Chirbes ein hochgradig finsteres Porträt der feinen spanischen Gesellschaft vorgelegt. Im Mittelpunkt steht der Bauunternehmer Ruben, der mit seinen Hotelbauten ungeniert die spanische Mittelmeerküste verhunzt. Dabei entstammt er einer Generation, die ganz andere Ideale hatte: Che Guevara, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, das waren die Helden der linken Jugend unter Franco, Symbole einer Politik, nach der sie ihr Leben richteten. Umso erstaunlicher, dass alles dann ganz anders kam, nicht das Bewusstsein, sondern die Lust am guten Dasein die Regie über die Lebensführung übernahm.
Was bleibt von dieser Generation? Die Melancholie bei den einen. Der Zynismus, die Geldgier und der Sex bei den anderen. Viel ist in dem Roman vom Sex die Rede, im direkten und im übertragenen Sinn, und zwar in durchaus derber Sprache. „Sie haben uns gefickt“, raunt einer der Protagonisten; „sie haben uns beschissen: Griechen, Römer, Goten, Hunnen, Mongolen, Teutonen, Ungarn, Deutsche, Russen.“ Allesamt haben sie Spanien beschissen, kann man die Weltsicht dieser Figur verstehen, weshalb Spanien nun als das große historische Opfer dasteht. Warum gerade Spanien? Der Protagonist weiß es selber nicht. Mehr denn als historische Analyse versteht sich solches Geraune als Ausdruck schlechtgelaunten Überdrusses an einer Welt, die nicht so tickt, wie man es gerne hätte. Die Figuren arrangieren sich trotzdem mit ihr, allen voran Rubén, der Spekulant. „Wir haben getan, was zu tun war“, geht es ihm durch den Kopf; „das nennen die Klassiker der Ökonomie primitive Kapitalakkumulation, das Land musste eine neue Klasse herausbilden und wusste nicht, wie.“ Seitdem, kann man hinzufügen, hat das Land gelernt, dank einer Generation, die aus ihren Träumen erwacht ist und dann antrat, die Wirklichkeit zu erobern – eine Wirklichkeit, die zugrunde geht wie jene Ideologien, in deren Namen die Welt, lange ist´s her, einmal eine bessere werden sollte.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...