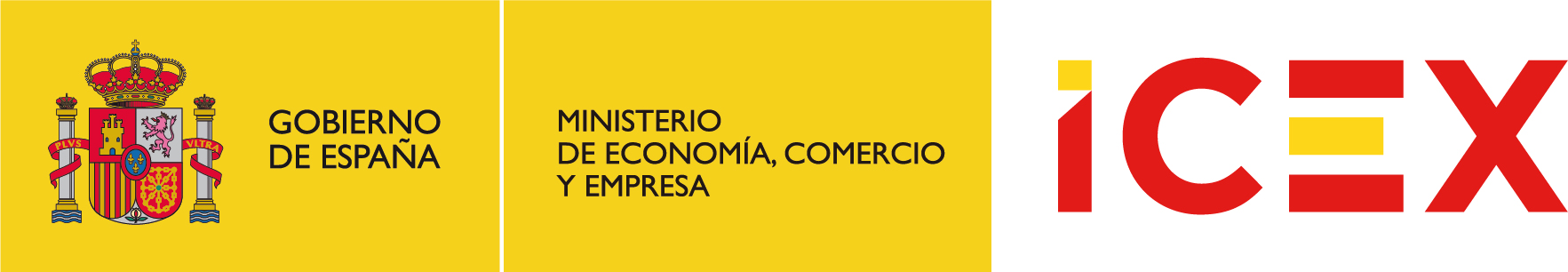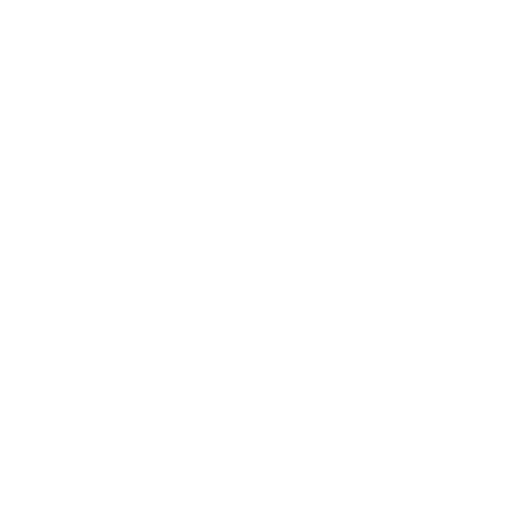Notizen zum literarischen Journalismus in Deutschland und Spanien
«Ein Feuilleton schreiben heißt auf einer Glatze Locken drehen». So lautet das vernichtende Urteil von Karl Kraus über die Gattung die, wie kaum eine andere, die Vereinigung zwischen Literatur und Journalismus im deutschsprachigen Raum verkörpert. Der unerbittliche Wiener Satiriker bezeichnete das Feuilleton als dilettantisch und «französling» und beschuldigte es, die Strenge und Tiefe der deutschen Sprache zu unterwandern. Der Erfinder dieser «verächtlichsten Form der Literatur» stand für ihn auch fest: Heinrich Heine.
Heinrich Heine (1797-1856), der zerrissene Dichter, der den Romantizismus zum höchsten Ruhm erhob —um ihn kurz danach zu beerdigen— revolutionierte zugleich den Journalismus seiner Zeit. Die neue Gattung hat er nicht erfunden, sondern während seines Pariser Exils entdeckt. Denn in der aufstrebenden Presse der französischen Metropole erfreute sich das feuilleton —ursprünglich eine kulturelle Rubrik, die Theateraufführungen und neue Bücher besprach— großer Beliebtheit. Dem französischen Muster folgend, drehte Heine wunderschöne Locken, verdeutschte sie und sandte sie in seine Heimat, wo sie trotz Zensur und gewisser Vorurteile seitens des «Teutschtums», auf eine breite Leserschaft unter dem liberalen Bildungsbürgertum stießen. Bald fanden sich auch zahlreiche Nachahmer, die eine rasche Verbreitung innerhalb des deutschsprachigen Europas ermöglichten: Zur Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert sich das Feuilleton als fester Bestandteil der Zeitungen in Berlin, München, Frankfurt, Prag oder Wien.
Es war vor allem die Hauptstadt der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die sich die neue Gattung regelrecht einverleibte. In Wien wuchs das Feuilleton zur beliebtesten literarischen Übung der «Kaffeehausliteratur», in den Cafés der Jahrhundertwende —Café Central, Griensteidel— gediehen die ersten professionellen Feuilletonisten: Ferdinand Kürnberger, Daniel Spitzer, Ludwig Speidel, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Alfred Polgar... Und hier wurden auch die Merkmale der Gattung endgültig festgelegt: ein leichter und umgangssprachlicher Ton —der oft in den Plauderton übergeht oder dialektal gefärbt ist—, die Vorliebe für Wortspiele, Einfälle und Gedankenblitze, eine Mischung aus Mondänität und Transzendenz, aus Lokalpatriotismus und kosmopolitischer Weltanschauung…, in summa: Eine Prosaminiatur, die das Kunststück schafft, über alle möglichen Themen —auch sehr ernsthafte— in einer lockeren Art zu unterhalten.
Nach einer Periode des Verfalls, bedingt durch die natürliche Abnutzung eines jeden Genres und später auch durch den vernichtenden Weltkrieg, erlebt das Feuilleton eine neue Glanzzeit in den 20iger Jahren. Das kulturelle Zentrum ist jetzt nicht mehr Wien, sondern Berlin. Während der Weimarer Republik entsteht in der preußischen Hauptstadt eine machtvolle und solide Presseindustrie: Über 150 Tageszeitungen mit zum Teil sehr hohen Auflagen überschwemmen die Stadt. Berlin fungiert wie ein Magnet für Journalisten aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Zu den echten «Blutjournalisten» wie Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch, Victor Auburtin oder Anton Kuh gesellen sich prominente Literaten und Intellektuelle, die angelockt durch die Resonanz und die Honorare —«Wenn Sie in Zukunft etwas von mir in Zeitungen sehen sollten, dann beten sie ein Vaterunser für mich, denn es ist immer ein Zeichen, dass ich mich in Geldverlegenheiten befinde» (Robert Musil)— ihre Feder im Dienste des neuen Mediums stellen. Um nur einige zu nennen: Stefan Zweig, Hermann Hesse, Thomas Mann, Alfred Döblin, Joseph Roth, Robert Walser, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin oder der eben zitierte Robert Musil. Das Feuilleton der Weimarer Republik erreicht somit eine nie dagewesene literarische Qualität, es gewinnt an Reichtum und Tiefe und ist zugleich imstande, die Widersprüche und die rasche Entwicklung der modernen Welt mit ihren zahlreichen kulturellen und künstlerischen Innovationen zu reflektieren. Und aufgrund der politischen Instabilität und der wachsenden Bedrohungen, wird es zudem kritisch und engagiert; es stellt sich in den Dienst der littératur engagée.
Diese Blütezeit des Feuilletons erlebt ein abruptes Ende mit der Machtübernahme der Nazis im Jahre 1933. Die strikte Zensur und die «Gleichschaltung» der Presse durch Propagandaminister Joseph Goebbels wirkt wie ein Schuss ins Genick einer Gattung, die für die Nazis als Musterbeispiel der «Asphaltliteratur» und der «entarteten Kunst» galt. Die «Ausrottung» des Feuilletons bedeutete zugleich einen regelrechten Exodus ihrer Vertreter, die zum großen Teil Juden waren.
Mariano José de Larra (1809-1837) spielt in der Geschichte des spanischen Journalismus eine ähnliche Rolle wie Heinrich Heine in Deutschland. Er lebte etwa zur gleichen Zeit und trotz seines kurzen Lebens —er beging Selbstmord mit 29 Jahren— gilt er als der Begründer des literarischen Journalismus in Spanien. Seine artículos knüpfen nicht direkt an die Tradition des französischen feuilletons, sondern eher an die des essays des Londoner Spectator, jene liberale Zeitschrift, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter dem bürgerlichen Publikum ein neues und aufgeklärtes Gedankengut zu verbreiten trachtete. Aber ähnlich wie Heine gelang es Larra dank eines scharfsinnigen und kritischen Blickes, einem starken Subjektivismus und einem natürlichen, unkonventionellen und oft ironischen Ton, den journalistischen Artikel gründlich zu erneuern.
Im Laufe des 19. Jahrhundert gab es eine Reihe bedeutender Schriftsteller —Vicente Blasco Ibañez, Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín…—, die, in Larras Nachfolge, mit ihren artículos der Presse zu hohen Auflagen verhalfen. Aber es war die Generación del 98, die den articulismo zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur ersten Blütezeit in Spanien führte. Miguel de Unamuno betrachtete die eigene journalistische Tätigkeit als seinen wichtigsten Beitrag zur literarischen, politischen und moralischen Geschichte des Landes. Einige seiner berühmtesten Werke, wie En torno al casticismo, Del sentimiento trágico de la vida oder Contra esto y aquello, sind eigentlich Sammlungen von Artikeln, die er in den Tageszeitungen La España Moderna oder La Nación veröffentlichte. Es gab damals kaum einen anerkannten Schriftsteller der, sei aus Berufung oder gelockt durch Ruhm und Geld, nicht zugleich als articulista tätig war: Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, José Martínez Ruiz ´Azorín´, Juan Ramón Jiménez … Selbst der renommierteste Kopf dieser Zeit, der Philosoph José Ortega y Gasset, zeigte keine Berührungsängste mit der Presse und publizierte zahlreiche Artikel für verschiedene Tageszeitungen.
Der wirtschaftliche Aufschwung der zwanziger Jahre bringt auch in Spanien eine blühende Presselandschaft hervor, so dass die nachfolgende Generación del 14 die Tradition des articulismo fortsetzt: Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, Corpus Barga, Gabriel Miró, Miguel Mihura, Edgar Neville, Julio Camba… Nicht zu vergessen sind hier Josep Pla und Eugeni Xammar, die sowohl in katalanischer als auch in spanischer Sprache schrieben und für die Geschichte des spanischen Journalismus unentbehrlich sind.
Ähnlich wie in den letzten Jahren der Weimarer Republik, erleben wir im Spanien der Segunda República und des Bürgerkrieges eine starke Politisierung des articulismo, der oft zum reinen Propagandamittel mutiert. Der Sieg Francos im Jahre 1936 bedeutet auch hier eine abrupte Zäsur. Für die gesamte Kulturwelt Spaniens folgen karge und dunkle Jahrzehnte und erst mit der Lockerung der Zensur im Jahre 1966 erhellt sich etwas die Lage. Für den articulismo beginnt jetzt die Zeit der sogenannten «Stilisten mit Unterlassungsdelikt», d. h. jene angepassten Journalisten wie Jaime Campmany, Emilio Romero oder Francisco Umbral, dessen Artikel durchaus literarische Qualität zeigen ohne jedoch —aus Überzeugung oder aus Selbstzensur— einen direkten und kritischen Blick auf die Realität zu wagen.
Die achtziger Jahre bringen eine Renaissance des literarischen Journalismus, als logische Folge der Pressefreiheit, die während der Transición wiedereingeführt wurde. Man hat versucht, diesen Nuevo Periodismo mit dem amerikanischen New Journalism in Verbindung zu setzen, was jedoch zu relativieren ist, vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Reportage, die Sterngattung des New Journalism, in Spanien selten praktiziert wurde (im Gegensatz zu Lateinamerika, wo sich die nuevas crónicas eindeutig an die Reportagen des New Journalism anlehnen). In Spanien hat man die Augen mehr auf die eigene Tradition gerichtet. Der klassische artículo wurde wiederaufgenommen, natürlich mit anderen Merkmalen und auch oft mit dem neuen Namen columna. Ohne die gesellschaftskritische Komponente aus dem Auge zu verlieren, zeigt diese modernisierte Version eine ausgeprägte Literarisierung —voluntad de estilo— und zugleich einen starken Subjektivismus, so dass man oft von columna de autor spricht. Wichtig ist nicht das Objekt, sondern den Blick, den man darauf wirft. Die Geschichten aus der realen Welt, die in den columnas geschildert werden, gelten als Ansporn für die Introspektion oder die freie Abschweifung. Zugleich wendet man sich oft direkt an den Leser und sucht seine Komplizenschaft: Wie Juan José Millás, einer der prominentesten columnistas erklärt: «Wenn ich schreibe, denke ich immer an Sie».
Der lange und nicht selten parallel verlaufende Weg des Feuilletons und des artículos mündet in einer Gabelung. Nach dem Zweiten Weltkrieg überlebte das deutsche Feuilleton mehr schlecht als Recht —vor allem in Zeitungen der ehemaligen DDR—, ohne das Interesse der großen Autoren zu wecken: weder Günter Grass noch Martin Walser, Arno Schmidt oder Uwe Johnson ließen sich für das Feuilleton begeistern (womöglich noch abgeschreckt vom Urteil Karl Krauss). Und das Gleiche gilt für die Autoren der Gegenwart. Heutzutage scheint das Feuilleton ein nostalgisches Dahinschleichen zu durchleben, verirrt zwischen der Glosse und dem Blog. Manche Zeitung behält noch den Namen Feuilleton als Überschrift für den kulturellen Teil, aber die goldenen Zeiten des Feuilletons als literarische Gattung findet man nur noch in den Geschichtsbüchern.
Ganz anders die Situation in Spanien. Die Präsenz der Schriftsteller in den Zeitungen ist hier besonders ausgeprägt, die Grenzen zwischen Literatur und Journalismus sind verschwommen. Der artículo oder die columna sind allgegenwärtig, kaum ein bekannter Autor, der nicht wöchentlich in El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia oder in den zahlreichen Provinzblättern sein kurzes Prosastück publiziert. Die Liste ist lang: Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas, Manuel Vázquez Montalbán, Rosa Montero, Maruja Torres, Almudena Grandes, Arturo Pérez Reverte, Enrique Vila-Matas, Manuel Rivas, Manuel Vicent... Wie letzterer neulich in einem Interview gesagt hat: «In England oder in Deutschland versteht man kaum, dass jemand zugleich Journalist und Schriftsteller sein möchte». Vielleicht sollte man hinzufügen, dass mancher es in Spanien auch nicht versteht. Oft gewinnt man den Eindruck, dass eine regelrechte Inflation von columnistas herrscht. Infolgedessen hat sich neuerdings ein neuer Begriff etabliert, der des opinador oder opinólogo, was so viel heißt wie jemand, der zu Allem eine Meinung hat (ob er auch von Allem die entsprechende Ahnung hat sei dahingestellt). Aber auf der anderen Seite, ist es begrüßenswert, wenn die Schriftsteller vom Elfenbeinturm heruntersteigen und sich in den Medien zeigen. Zum einem, weil die intellektuelle und politische Debatte angespornt werden kann und zum anderen, weil sie somit für ein breiteres Publikum zugänglich sind. In einem Land mit einer nicht sehr breiten Leserschaft ist dies nicht zu unterschätzen.
Francisco Uzcanga Meinecke
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...