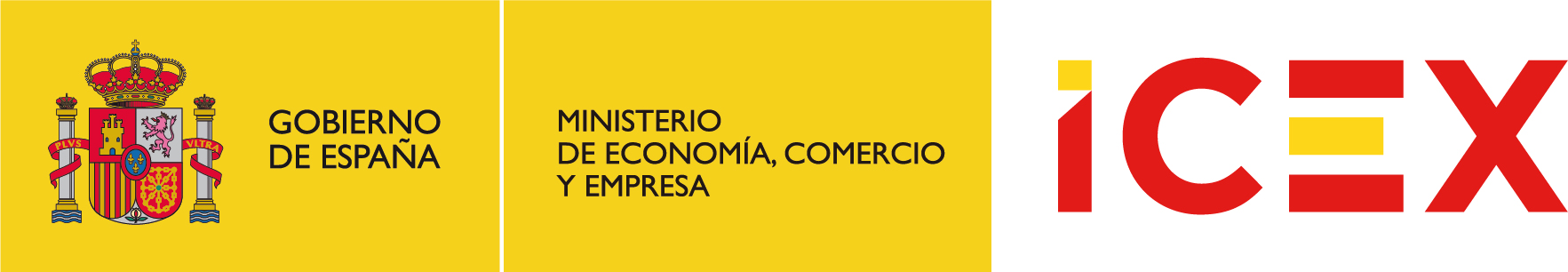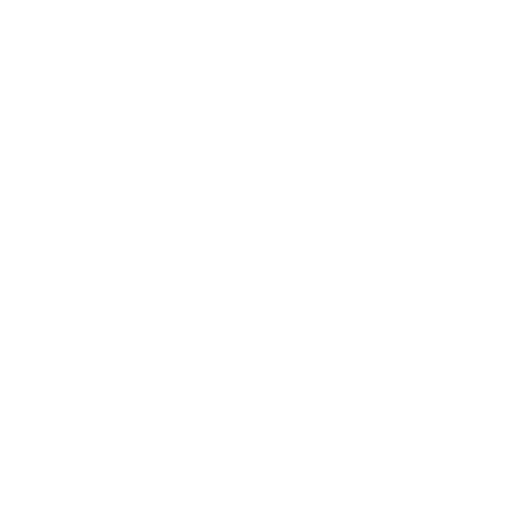Wenn wir Leser und Buchhändler in deutschen Buchhandlungen befragten, sie sollten uns zeitgenössische Autoren aus Spanien nennen, bekämen mit großer Wahrscheinlichkeit zwei Namen die meisten Stimmen: Carlos Ruis Zafón und Javier Marías. Wie wir wissen, haben die beiden diesen Ruhm zwei Erwähnungen an exponierter Stelle durch populäre Personen in den öffentlichen Medien zu verdanken: der Lobeshymne Reich-Ranickis in seinem Literarischen Quartett für Javier Marías’ Mein Herz so weiß und der Empfehlung von Carlos Ruiz Zafóns Im Schatten des Windes durch den damaligen Außenminister Joschka Fischer in Elke Heidenreichs Sendung „Lesen!“.
Selbstverständlich sind dieses große Glücksmomente für die betroffenen Autoren, Verlage und Lizenzverkäufer.
Aber bei aller Bewegung, die sie provozieren, führen solche Sternstunden nicht dazu, dass die schreibenden Landsleute der Auserwählten mit ihren bereits in der fremden Sprache erschienenen Werken unterstützenden Auftrieb erhielten oder dass sich dadurch der Markt für sie neu oder für andere, noch unveröffentlichte Autoren entscheidend öffnete.
Unter Umständen gelangen im Schlepptau der neuen Galionsfiguren ein paar Lizenzen mehr über die Grenzen, aber immer verbunden mit einer großen Gefahr: Die Autoren, die Lektoren und Agenten, selbst die Feuilletons, erwarten jedes Mal einen mindestens ebenbürtigen Erfolg, der sich nur sehr selten einstellt. Die Erwartungshaltung schnellt auf riskante Höhen. Und mit ihr preschen die Lizenzvorschüsse für Folgewerke der plötzlich berühmt Gewordenen in spektakuläre bis anstößige Sphären vor und graben damit anderen das ökonomische Wasser ab.
Ob eine ausländische Literatur und ihre Macher in fremden Ländern eine angemessene, hoffentlich sogar populäre Rezeption erfahren, die sich womöglich auch fest und kalkulierbar etabliert, hat entscheidend damit zu tun, wie tief und lang die geschichtlichen und politischen, vor allem aber kulturhistorischen Beziehungen zwischen den Ländern oder Sprachen geprägt sind.
So ist es in keinem Fall überraschend und leicht nachzuvollziehen, wie tief verwurzelt die kulturellen und damit literarischen Wechselbeziehungen von Italien, Frankreich, den skandinavischen oder slawischen Kulturkreisen mit Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind und wie weit sie in die Vergangenheit reichen.
Eine solch profunde oder lange Verbindung zwischen Spanien und dem deutschen Sprachraum hat es nie gegeben. Im Gegenteil war es immer ein vorrangiges und erschreckend gut gelungenes Vorhaben der totalitären Regime auf der Iberischen Halbinsel, den Kontakt zum meist demokratischen Rest der europäischen und übrigen Länder zu unterbinden.
So gab es auch im vergangenen Jahrhundert keine Tradition in eher intellektuellen oder gebildeten Kreisen - also von Leuten, die nicht nur Bücher lesen, sondern sie auch machen - sich mit Spanien in der Form auseinanderzusetzen, dass es zu einem regen Austausch hätte kommen können.
Was man von Spanien wusste oder wissen wollte, schien fast mit unilateraler Lektüre abgedeckt, Orwells Katalonien oder Enzensbergers kurzer Sommer der Anarchie mussten reichen, das Interesse an originalen Stimmen war eher gering.
So war der Prozess der politischen und kulturellen Öffnung, dem sich Spanien nach dem Tod des Diktators und der schrittweisen Etablierung einer Demokratie stellen musste, von essentieller Wichtigkeit. Aber auch von außen musste etwas getan werden.
Man fand bis in die späten neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den deutschsprachigen Verlagen nur sehr vereinzelt Lektoren und Lektorinnen, die Spanisch lasen, verlegerische Entscheidungen waren folglich sehr oft, und damit vielfach nicht in voller Überzeugung, nur durch die Gutachten von Außenlektoren abgesichert.
Eine sehr wichtige Initiative war es darum, zumindest schien es zunächst so, dass die Frankfurter Buchmesse in den achtziger Jahren Spanien zu ihrem Ehrengast des Jahres 1991 kürte. Dieses Datum fiel mit vielen weiteren Ereignissen zusammen, die auf Spanien ein großes mediales Licht werfen sollten: die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona, die Weltausstellung in Sevilla, der fünfhundertste Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus.
Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse nimmt ja besonders die deutschsprachigen Verlage in die Pflicht, im Falle von 1991/Spanien brachte es sie in großen Zugzwang, denn nur sehr verstreut gab es bereits zeitgenössische spanische Autoren in den Katalogen.
Insgesamt war die Luft also dünn, so begann das große, allgemeine Rennen auf Autoren, die 91er-Herbstkataloge, die Sonderaktionen, die Medien brauchten Stoff. In diesem Zug konnten tatsächlich sehr viele Lizenzen vermittelt werden, zur großen Freude der Betroffenen.
Plötzlich drängten viele Autoren aus Iberien in deutsche Feuilletons und Buchhandlungen. Aber wirkliche Langzeitwirkung stellte sich nicht ein, denn noch war die Zeit nicht reif, noch fanden sich nicht genug wirklich interessierte Leser, die einen bleibenden Erfolg hätten garantieren können.
So verschwand der allergrößte Teil der 1991 debütierenden Autoren wieder schnell in der Versenkung, sprich: Makulatur. Insgesamt eher enttäuschende Verkaufszahlen gaben kaum einem Verleger Argumente an die Hand, da weiterzumachen, wo man mit sehr schönen Ausgaben und guten Übersetzungen angefangen hatte.
Doch ganz langsam veränderten sich die Dinge: Spanien rückte in den kommenden Jahren stückweise verstärkt in das allgemeine Bewusstsein, sicher begünstigt durch globalisierende Effekte. So wuchs auch das Interesse an seiner Kultur.
Und ganz langsam drangen aus den Universitäten immer mehr Menschen in die Lektorate, die Spanisch lasen, die Spanien kannten, die von den Büchern und ihren Autoren wussten, die dort geschrieben und publiziert wurden, oder von solchen, die dort schon lange vorher existierten.
Und im Gegenzug tauchten mittlerweile immer mehr spanische, katalanische, galicische, und baskische Autoren in deutscher Sprache auf und gewannen eine relevante Zahl an Lesern.
Heute gehören Autoren aus Spanien zum Standard eines Publikumsverlages, zumindest im belletristischen Bereich, abgesehen von den unabhängigen Verlagen, die sich schon immer in unbeirrter Weise über Trends hinweggesetzt und Schriftstellern von der Halbinsel auch bereits früher wertvollen Platz geboten hatten.
Sicherlich muss auf den Feldern der non-fiction und des Kinder- und Jugendbuchs noch manches bestellt werden, da herrscht noch ein großes Übergewicht in den deutsch-spanischen Beziehungen, zu klaren Ungunsten der Süd-Nord-Richtung.
Aber geben wir uns keinen Illusionen hin: es gibt noch sehr viel zu tun und es wäre unangebracht, in den Bestrebungen nachzulassen. Zu schnell verändern sich gerade heute die Moden und Bedürfnisse.
Den Ideen und Initiativen sollten und dürfen keine Grenzen gesetzt werden. Als jemand, dessen Beruf es ist, der sogar einen Teil seines Unterhalts davon bestreitet, Literatur von der Iberischen Halbinsel in andere Sprachen und Länder zu transportieren, eben auch in die Länder, in denen Deutsch gesprochen und gelesen wird, kann ich eine Unternehmung nur begrüßen wie diese Website, auf der man mich dankenswerterweise eingeladen hat, meine Sicht der Dinge darzustellen.
Viele weitere Ideen sind vorstellbar, die auch alle machbar scheinen und nicht allzu viel Geld bedeuteten, gerade wenn man die Initiativen in Partnerschaften verpackte: gegenseitige Praktika in den Verlagen, gegenseitig deshalb, weil auch die Literaturproduzenten in Spanien sehr viel aus einem nach wie vor verlegerischen Schlaraffenland wie Deutschland lernen könnten.
Vermehrte Workshops und Stipendien für Übersetzer würden den Austausch vertiefen, auch immer wieder lustvolle Angebote, wie Verleger-, Presse-, aber warum nicht auch Leserreisen zu Ereignissen wie dem Día de Sant Jordi in Katalonien, einer Feria del Libro in Madrid, zu dem alljährlichen Krimifestival in Gijón an der nördlichen Atlantikküste. Einige deutsche Verlage arbeiten bereits mit Scouts in Spanien, auch das ist ein gutes Barometer, um gut über das literarische Klima informiert zu sein, auch im Vorfeld der Publikationen.
Auch ganz praktische Hilfe ist gefordert, wie Subventionen für Übersetzungen, Produktionskosten oder Autorenreisen, die das verlegerische Risiko mildern könnten.
Und so bekämen mit Glück sogar solche Autoren wieder einen Platz oder dürften das allererste Mal auf Deutsch erscheinen, die wir zu den modernen Klassikern der spanischen Literatur rechnen: Federico García Lorca, Rafael Alberti Ramón del Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno, oder auch Pedro Salinas, Miguel Hernández und Luis Cernuda.
Von vielen verschiedenen Bedingungen hängt es ab, von intensiver Arbeit und grenzüberschreitender Phantasie, aber auch von staatlichen Subventionen, den betroffenen Berufsverbänden oder von Sponsoren und Stiftungen, die bilateralen Beziehungen zu vertiefen. Die Basis dazu werden aber immer die beteiligten Menschen bleiben, ob es die Autoren, die Verleger, die Leser, die Presse oder die Agenten sind.
Wir haben also noch viel Strecke vor uns und brauchen dafür einen langen und anhaltenden Atem – auf dem Lauf in beide Richtungen!
Zum Autor:
Guenter G. Rodewald lebt und arbeitet seit 25 Jahren als Literaturagent in Barcelona. Er wurde als Sohn eines Buchhändlers in Bremen geboren und übte diesen Beruf später selbst sieben Jahre in seiner Heimatstadt aus (Buchladen im Ostertor). Er schreibt als Kolumnist und Barcelona-Korrespondent für den 'BuchMarkt' und andere Fachorgane und Internetportale und unterrichtet bei Masterkursen für angehende Verlagsmitarbeiter an der Universitat Autónoma de Barcelona. An der Universitat de Barcelona betreute er zusammen mit Sandra Rodericks praxisbezogene Seminare zum Thema „Berufsmöglichkeiten für Philologen im Publishing: Der Weg des Buches vom Manuskript zum Leser“.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...