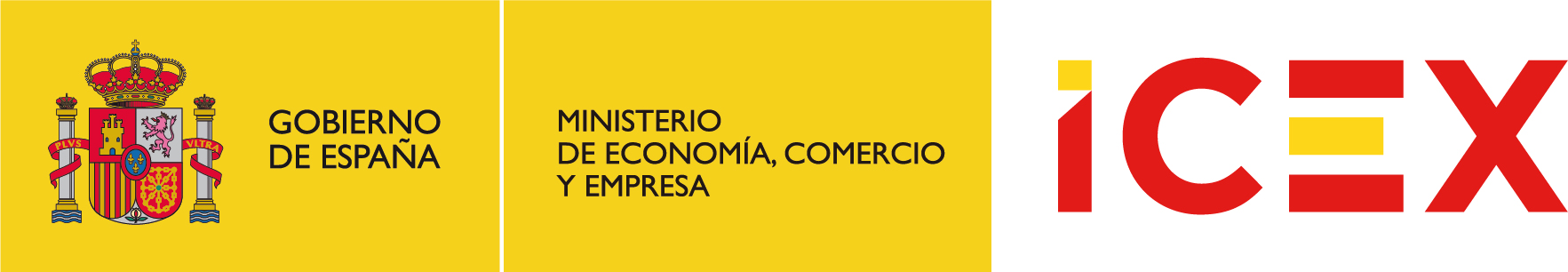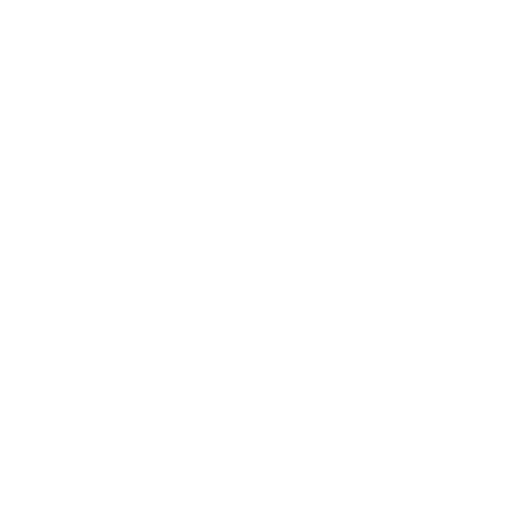El Evangelio según María Magdalena (Das Evangelium nach Maria Magdalena)
Autorin: Cristina Fallarás
Verlag: Penguin Ramdom House, Barcelona 2021, 238 Seiten
Gutachterin: Maria Hoffmann-Dartevelle
In ihrem 2021 erschienenen Roman El Evangelio según María Magdalena lässt die spanische Autorin und Journalistin Cristina Fallarás, die in ihrem Land als engagierte Feministin bekannt ist, die biblische Figur der Maria Magdalena zu Wort kommen. Im Rückblick schildert diese die Jesus-Geschichte aus einer ungewohnten Perspektive, rückt vieles zurecht, was in ihren Augen von den Anhängern des „Messias“ verzerrt dargestellt wurde, und betont eindringlich die tragende Rolle der Frauen in der biblischen Geschichte. Der Roman kann durchaus als provokantes feministisches Manifest gelesen werden.
In ihrem historischen Roman El Evangelio según María Magdalena lässt Cristina Fallarás ihre Protagonistin Jahrzehnte nach den Geschehnissen vom Wirken und Tod des „Nazareners“ erzählen. Auch über ihr eigenes Leben berichtet sie. Magdalena, im Roman eine Nachfahrin von Salome Alexandra, Königin von Judäa, schildert ihre mutterlose Kindheit in der Obhut des geliebten Vaters, der mit Fischkonserven handelt und in dessen Haus auch weise Ärztinnen und Hebammen arbeiten. Im unruhigen Galiläa, in dem der Widerstand gegen die römischen Besatzer gärt, fällt Magdalenas Vater dem Terror der Zeloten zum Opfer. Die junge Magdalena geht daraufhin nach Rom, wo sie ein ausschweifendes Leben führt, beschließt aber nach einigen Jahren, nach Galiläa zurückzukehren, um den väterlichen Betrieb zu führen. Ihr zur Seite steht ein stummer Mann, der „Gigant“, eine offenbar von Fallarás geschaffene Figur, die wie ein hilfreicher Schatten die Familie begleitet.
Nach und nach verliert Magdalena die für sie arbeitenden Fischer an den „Nazarener“, wie sie ihn durchgehend nennt, dessen Anziehungskraft immer stärker wächst. Als beide sich zum ersten Mal begegnen, erkennen sie einander augenblicklich als Gleichgesinnte. Es entwickelt sich ein tiefes Verständnis, wenngleich Magdalena stets ihren kritischen Blick wahrt, und eine körperliche Liebesbeziehung, die jedoch in der Erzählung keinen großen Raum einnimmt. Was beide vor allem verbindet, ist ihr revolutionärer Geist, ihre Vision von einer freien, gewaltlosen Zukunft. Auf die Bereitschaft des „Messias“, sich für seine Ideale zu opfern, reagiert Magdalena mit Enttäuschung und Wut, spätestens hier zeigen sich Divergenzen in ihren Haltungen.
Immer wieder schildert Magdalena das leidvolle Schicksal der Frauen ihrer Zeit, jedoch auch ihre im Verborgenen entfaltete Stärke, etwa als Heilerinnen und Versorgerinnen. So übernehmen die Frauen die Aufgabe, die Jünger des Nazareners und die Scharen seiner Verehrer zu verpflegen. Magdalena entmystifiziert die dem Nazarener zugeschriebenen Wunder, schildert etwa die „wundersame Brotvermehrung“ als eine von Frauen im Voraus organisierte Versorgung der Massen mit Brot und Fisch. Einige Wunderheilungen entlarvt sie konkret als Erfindungen. Im Zusammenhang mit den Nachfolgern Jesu fällt zudem immer wieder das harte Wort „Idioten“; den Aposteln wirft sie Schwäche, Treulosigkeit und die Verbreitung von Lügen vor.
Die Anprangerung der Lüge ist ein wesentliches Element in Magdalenas Bericht. Auch beklagt sie, dass die Botschaften des Nazareners schließlich in einen Gedanken gemündet seien: dass Erlösung nur durch Qual und Tod zu haben sei. Sie, die Gewalt ablehnt, nimmt vehement Anstoß daran und macht dafür jene verantwortlich, die die Botschaften des Nazareners verbreiten.
Indem sie dem Nazarener unterstellt, er habe mittels Simulation den Umsturz erreichen wollen und den Wunsch gehegt, durch sein Handeln in die Ewigkeit einzugehen, verschont die Erzählerin mit ihrer Kritik auch den Mann nicht, den sie liebt; sie wirft ihm, dessen Friedens- und Liebesbotschaft ihr so viel bedeutet, männliches Streben nach Macht und Größe vor, fühlt sich teilweise sogar von ihm benutzt. Das Opferprinzip, das er den Menschen vorlebt, lehnt sie kategorisch ab.
Magdalena lüftet in ihrem Bericht auch das Rätsel um das Verschwinden Jesu aus seiner Grabkammer, indem sie es als einen Akt der Frauen erklärt. Den Gedanken der Auferstehung betrachtet sie als Unsinn. Und dennoch sagt sie ganz zum Schluss, sie habe den Nazarener nach seinem Tod noch einmal getroffen. Womit diese und viele andere Fragen offen bleiben.
Im Erzählstil des Romans mischen sich Pathos, insistierende Wiederholungen und emotionale Bildersprache mit den rationalen Analysen einer selbstständig denkenden, geistig unabhängigen, stolzen und klugen Frau, die in der Zurückhaltung und dem verborgenen Wirken der Frauen ihrer Zeit durchaus eine Stärke sieht. Äußerst modern wirkt ihre mehrfach wiederholte Verweigerung des Gebärens. Aus ihrer Verachtung gegenüber Männern wie Petrus, die aus der Geschichte des Nazareners eigenen Ruhm bezögen, macht sie keinen Hehl.
Fallarás‘ Roman gewährt einen ungewohnten und dezidiert weiblichen Einblick in die Entstehung des Christentums und suggeriert, dass mit dem „Messias“ eine echte Revolution gegen das Establishment möglich gewesen wäre, die jedoch infolge der falschen Bezeugungen seiner Nachfolger wiederum zum Establishment verkommen sei.
Meiner Ansicht nach sprechen weder Inhalt noch Stil des Romans gegen eine Übertragung ins Deutsche. Das deutschsprachige Publikum wird ähnlich begeistert oder irritiert auf Magdalenas Bericht und radikale Behauptungen reagieren wie das spanischsprachige. Am ehesten wird das Buch wohl feministisch eingestellte Leserinnen und Leser interessieren.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...