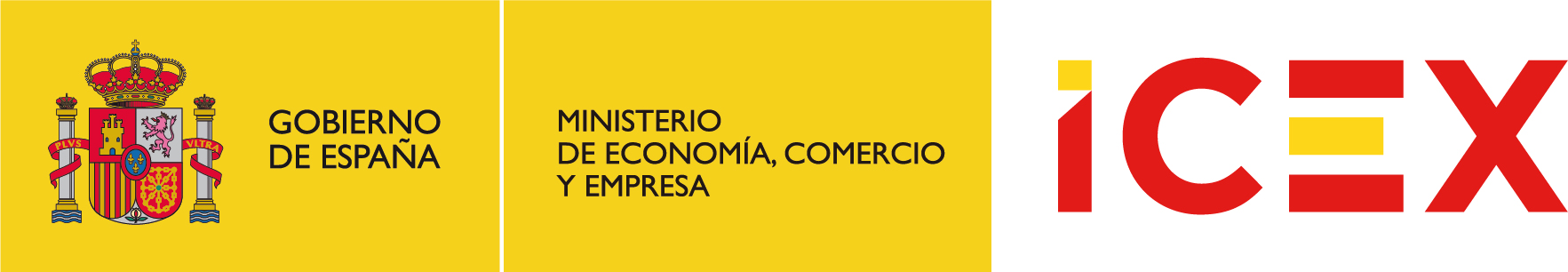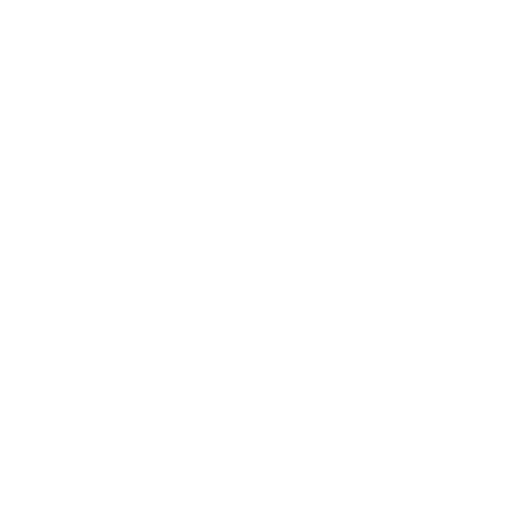In ihrem Roman „Un revólver para salir de noche“ erzählt die mehrfach prämierte tschechisch-spanische Schriftstellerin und Übersetzerin Monika Zgustova vom Leben der Russin Véra Nabokov an der Seite ihres berühmten Ehemannes. In Rückblenden beleuchtet sie entscheidende Lebensphasen des Paares und insbesondere Véras Rolle als Begleiterin des Autors. Neben den Beziehungsturbulenzen der Nabokovs wird dabei vor allem Véras gezielter Einfluss auf Werdegang und Werk des großen Schriftstellers sichtbar.
In klarer, oftmals sachlich beschreibender Sprache und mittels Gesprächen führt Zgustova dem Leser die Lebensstationen der Nabokovs und ihre jeweiligen Eigenarten vor Augen. Beide Protagonisten kommen im Abstand von wenigen Jahren um die Wende des 19./20. Jahrhundert in Sankt Petersburg zur Welt, er in einer aristokratischen, sie in einer bürgerlichen jüdischen Familie. Russische Revolution und Judenverfolgungen veranlassen ihre Familien zur Auswanderung nach Berlin. In der dortigen russischen Emigrantengemeinde lernen Vladimir und Véra sich kennen und heiraten 1925.
Nabokov, der bereits ein wechselhaftes Liebesleben hinter sich hat, lernt in Paris die russische Dichterin Irina Guadanini kennen und beginnt mit ihr eine leidenschaftliche Affäre, die beinahe zum Ende seiner noch jungen Ehe führt. Véra aber gelingt es, ihren Mann zu halten, indem sie droht, mit dem gemeinsamen Sohn Dmitri in die USA zu gehen. Irina wird lange Jahre Vladimirs Sehnsuchtsobjekt bleiben, seine Familie aber wird er nie verlassen. Zgustova schildert aus drei unterschiedlichen Perspektiven die Versuche beider Geliebter, zueinander zu kommen, die jedoch durch Véras stete Wachsamkeit vereitelt werden. Infolge der politischen Entwicklung in Deutschland siedelt die junge Familie 1940 in die USA über.
Der Roman spricht einige markante Ereignisse in Nabokovs Leben an, etwa den Tod des homosexuellen Bruders in einem deutschen KZ oder die Kindheitserlebnisse des Autors mit einem pädophilen Onkel, die ihm später Stoff für seinen Welterfolg „Lolita“ geliefert haben könnten. Zgustova betont den Einfluss eigener Erfahrungen mit Sexualität auf Nabokovs Schreiben und die starke autobiographische Prägung seines Werks.
Das Bild Véras, von der Autorin facettenreich gezeichnet, wandelt sich im Verlauf des Romans von dem einer beeindruckenden, kämpferischen Frau zu dem einer strengen, schonungslosen Wächterin über den Ruhm ihres Partners. Neben Vladimir, dem amüsanten, scharfsinnigen Unterhalter und Dozenten, dem Charmeur und Frauenschwarm erscheint Véra zunehmend als die kalte, kontrollierende, aber auch zähe, arbeitsame Partnerin, die den Alltag ihres Mannes regelt und überwacht. So sitzt sie in all seinen Vorlesungen in der ersten Reihe und unternimmt auch sonst einiges, um ihren Mann von seinen weiblichen Studentinnen und Verehrerinnen fernzuhalten. Nach der Affäre mit Irina hat sie von ihm verlangt, täglich Tagebuch zu führen, in einem Heft, in dem auch sie selbst ihre Eindrücke festhält.
Dass Véra seit Beginn ihrer Ehe alles daran setzt, das Werk ihres angehimmelten Mannes als erste Leserin, Ratgeberin und Schreibkraft mitzugestalten, wird im Roman immer wieder thematisiert. Viele Texte hätte der Autor wohl vernichtet, hätte nicht Véra es verhindert. Sie ist es auch, die ihren Mann nach der Übersiedelung in die USA immer wieder drängt, auf Englisch zu schreiben, und die die Übersetzungen seiner Werke ins Russische korrigiert. Nach seinem Tod übersetzt sie, die schon früh als Übersetzerin tätig war, selbst einige seiner Texte.
Über Gespräche und Andeutungen erfährt der Leser spät von jenem Detail, das dem Roman seinen Titel verleiht: Véra trug stets in ihrer Handtasche eine Browning bei sich. Offenbar kam die Waffe nie zum Einsatz, und es wird nicht wirklich klar, wen genau Véra schützen bzw. abwehren wollte. Dass diese Frage offen bleibt und auf die Waffe nur beiläufig eingegangen wird, erscheint eigenartig. Was auch immer sie verdeutlichen soll, sie bleibt ein Randelement.
Als der Welterfolg von „Lolita“ den Nabokovs in den Fünfzigerjahren ein sorgloses Leben beschert, gibt Véra sich dem Luxus hin und tritt wie eine Aristokratin auf. Von ihrer Umgebung wird sie vielfach als hochnäsig, kalt und sarkastisch wahrgenommen. Genau wie ihr Mann lehnt sie praktisch alle zeitgenössischen Autoren ab. In ihren Augen ist nur ihr Mann genial. Nach dessen Tod wird sie versuchen, ein unvollendetes Werk von ihm zu Ende zu schreiben, was ihr aber nicht gelingt. Doch ebenso wenig schafft sie es, dem Wunsch ihres Mannes nachzukommen und das Manuskript zu verbrennen.
1961 siedelt die Familie Nabokov in die Schweiz über, wo Vladimir 1977 stirbt, Véra 1991. Sohn Dmitri erleidet 1980 einen schweren Autounfall, der seine Karriere als Opernsänger beendet, und widmet sich fortan gemeinsam mit seiner Mutter der Verwaltung von Nabokovs Nachlass.
Als eine Schwäche des Romans erscheinen mir die häufigen Wiederholungen gewisser charakterisierender Details und manche Beurteilungen und Interpretationen, die die Autorin durchaus ihren Lesern hätte überlassen können. Teilweise fallen ihre Schilderungen etwas trocken aus. Dem Roman ist dennoch zugute zu halten, dass er einer einflussreichen weiblichen Figur der Literaturgeschichte Kontur verleiht.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...