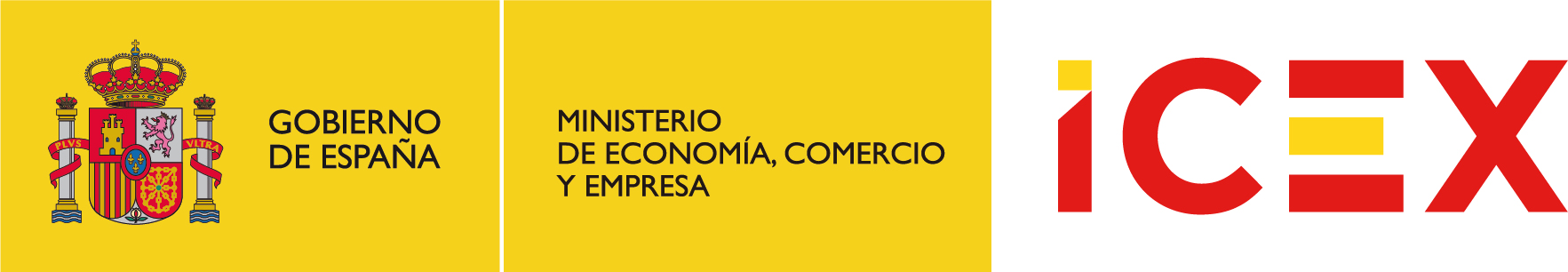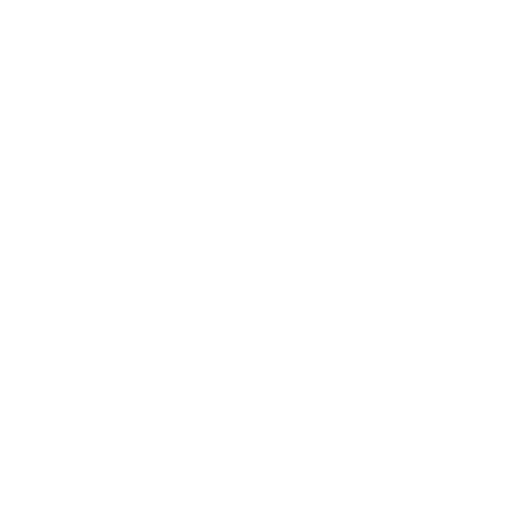Luis Landero ist ein geborener Erzähler, der mit seinem neuesten Buch die Leser auf fast 300 Seiten an den Lippen von Marcial hängen lässt, einem seltsam verschrobenen Außenseiter, der in der Manier eines tragischen Schelmen Bekenntnis ablegt über seine Liebe zu einer Frau außerhalb seiner Reichweite und seine Verwicklungen in ein katastrophales Finale. Im Zentrum des Romans steht der Mensch, getrieben von Bewunderung, Liebe, Hass und Neid, dem Wunsch dazuzugehören und daran zu scheitern.
Luis Landero (*1948, Albuquerque, Badajoz) wuchs in einfachen Verhältnissen in der Extremadura auf und zog mit seiner Familie achtzehnjährig nach Madrid, wo er verschiedenen Tätigkeiten nachging, einige Jahre als Gitarrist seinen Lebensunterhalt bestritt, dann spanische Literaturwissenschaft studierte und als Dozent arbeitete. Er war über vierzig, als er 1991 mit Juegos de la edad tardía seinen ersten und vielbeachteten Roman vorlegte. Seit damals sind alle seine Bücher beim renommierten Verlag Tusquets erschienen, und das sind nicht wenige; vor allem Romane, aber auch ein Essay und zwei Memoirenbände: El balcón en invierno (2014) und El Huerto de Emerson (2021). Große Beachtung erfuhr 2019 La lluvia fina, ein kunstvoll strukturierter Roman, der schonungslos unausgesprochene Vorwürfe, schwelende Konflikte und langgehegten Groll innerhalb einer Familie offenlegt, und von der Kritik als bester Roman des Jahres gelobt wurde.
In Una historia ridícula erzählt Marcial von einem tragischen Vorfall, der sich einige Jahre zuvor ereignet hat. Dabei gab es mehrere Verletzte, wenn nicht sogar einen Toten. Wieviel Schuld Marcial trägt, bleibt offen, aber es kam zu einem Gerichtsfall, und er ist seitdem in psychiatrischer Behandlung. Zu Anfang stellt er seine Person und seine Überzeugungen vor: ein Mann aus einfachen Verhältnissen mit einer guten Stelle in der Lebensmittelbranche, ohne akademische Ausbildung, aber mit einem breiten Allgemeinwissen und einer guten Ausdrucksweise, weswegen er auch die Idee seines Arztes, Doktor Gómez, aufgegriffen hat und dieses Selbstbekenntnis ablegt. Marcial philosophiert über die große Nähe zwischen Liebe und Hass und illustriert dies an Beispielen aus seiner Kindheit, als er in der Schule das Ziel von Bloßstellungen und Beleidigungen wurde.
Erst auf Seite vierzig beginnt er Pepita zu beschreiben, die Frau, in die er sich auf den ersten Blick verliebt und wegen der es zu dem schon erwähnten tragischen Ende kommt. Marcial ergeht sich in ausufernden Schilderungen ihrer Schönheit, ihres Kleidungsstils und ihrer hohen sozialen Herkunft. Seine Exkurse über verschiedene Formen des Hasses, die Angriffe auf seine Person und seine skurrilen manchmal fast abartigen Interessen – wie lange eine Schabe ohne Kopf überleben kann oder wieviele Mäuse eine Katze täglich fressen muss – sowie sein überzogenes Schwärmen für Pepita, die er wie Don Quijote seine Dulcinea bewundernd auf einen Sockel stellt, schüren, angefeuert vom steten Verweis auf die dräuende Katastrophe, eine gewisse, von Grusel getriebene Neugier, worauf das alles wohl hinauslaufen mag.
Marcial erinnert die erste Begegnung mit Pepita auf einer Lebensmittelmesse, das zufällige Zusammentreffen mit ihr auf der Straße in Begleitung ihrer Mutter, Tante und Hausangestellten. Er schafft es danach, sich mehrmals alleine mit ihr zu verabreden und sie lädt ihn sogar zu einem literarisch-musikalischem jour fixe aus Freunden und Verwandten im Haus ihrer Eltern ein. Er bereitet sich zu den Tête à têtes ausführlich vor, um in seinem Erscheinen und in seinen Konversationsthemen auf der Höhe ihres sozialen Status, ihrer Interessen und Vorlieben zu sein. Sie malt und zeichnet und begeistert sich für zeitgenössische Kunst, und so legt er sich eine Liste an einschlägigen Begriffen und künstlerischen Urteilen zu, um ihre Zeichenmappe kommentieren zu können. Aus Imponiergehabe gibt er sich als Philosoph und Schriftsteller aus und poliert eine Erzählung auf, die sein Lehrer in der Schule besonders gelobt hatte. In „Mi pequeña fauna” hatte der kleine Marcial keine anderen Freunde als die Insekten seiner Wohnung und eine Languste, die er aus Mitleid aus dem kochenden Wasser gezogen hatte. Die rührende Geschichte hat Pepita wohl ihren Freunden und Verwandten zu lesen gegeben, was Marcial bei der Tertulia zu bemerken glaubt und seinen desengaño einleitet. Obwohl er sich auf das soziale Event im Haus Pepitas so eingehend vorbereitet hatte, geht alles schief und seine Liebe zu ihr kehrt sich in Enttäuschung und Hass und mündet in die vielbeschworene Katastrophe. Dabei bleibt das genaue Geschehen verschwommen, verfügen wir mit Marcials Bekenntnis doch nur über seine Version und können als Leser zwischen Realität und Vision nicht unterscheiden.
Zu Beginn der Erzählung fällt es schwer, die Zeit der Handlung zu bestimmen. Marcials geschwollene Sprache und einige seiner Redewendungen erinnern stark an die Literatur des Siglo de Oro und dessen Ausdrücke wie „geneigter Leser“ oder „wie wir später noch erfahren werden“. Wie in den damaligen Mantel-und-Degen-Stücken beschwört auch Marcial immer wieder die große Bedeutung der Ehre und definiert sie in seinen ersten Sätzen als sein Lebensziel: „Me llamo Marcial Pérez Amiel, resido en Madrid, y tengo en muy alta estima el viejo concepto del honor”. Gleichzeitig ist das Spiel zwischen Sein und Schein, die Enttäuschung, die Marcial erfährt, als er die „wahre“ Pepita erkennt, dem Konzept des desengaño des Don Quijote nicht unähnlich. Und wie dort, ist auch hier die Leserschaft eingeweiht. Die Ich-Erzählung aus der Rückschau und die wiederholte Andeutung des dramatischen Endes passt ebenso zu den spanischen Schelmenromanen.
Ein weiterer sehr deutlicher Intertext ist Kafkas Die Verwandlung, augenfällig durch die genaue Beschreibung der personifizierten Insekten und die Auszeichnung des Kindes als „Honorar-Insekt“ in der eingefügten Geschichte „Mi pequeña fauna”. Zudem stellt Marcial selbst mehrfach den Bezug zu Kafka und dessen bekanntester Erzählung her.
Der Roman lebt von der schrägen Figur Marcials und seinem nicht enden wollenden Gedankenstrom, dem wir in einer Mischung aus Faszination und einem gewissen Widerwillen begierig bis zum Ende folgen. Una historia ridícula, der Titel spielt darauf an, hat auch viel Komik, aber eine mit Tragik gepaarte Komik. Marcial scheint aus der Zeit gefallen und ist es dann doch nicht, denn in seinen Worten über die großen Gefühle, steckt auch viel Wahrheit, eine Wahrheit, die wir anderen und noch nicht einmal uns selbst gegenüber ungern zugeben mögen.
Vier von Landeros Romanen sind bisher auf dem deutschen Markt erschienen, allerdings liegen diese schon weiter zurück. Ich empfehle den Faden mit Lluvia fina und Una historia ridícula wieder aufzunehmen; Schwierigkeiten für eine Übersetzung sehe ich keine.
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...