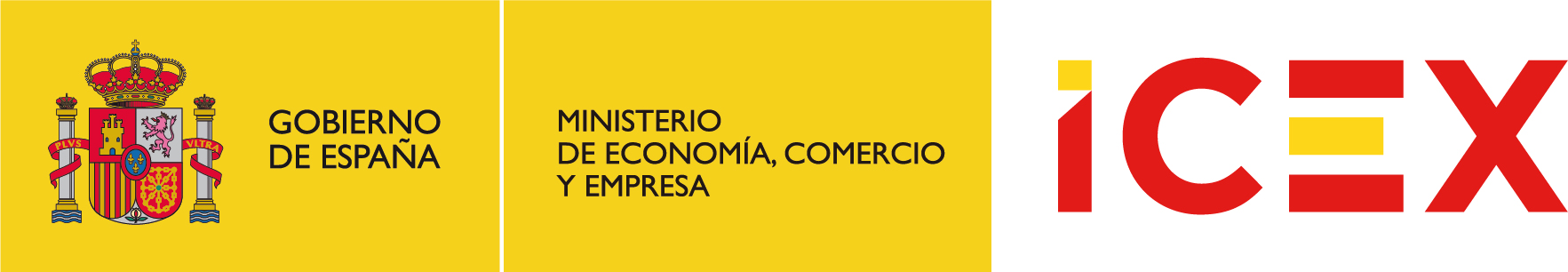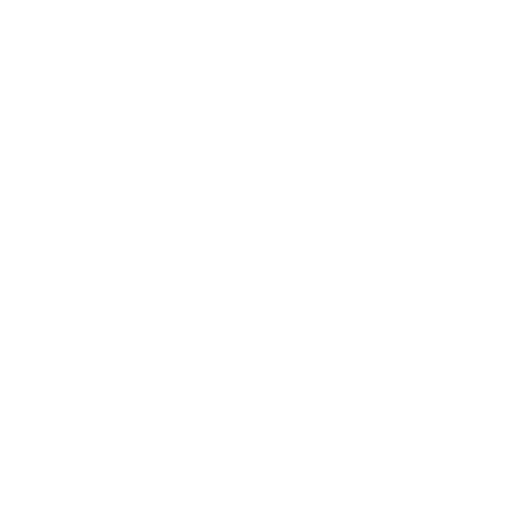Gordo de feria (Dicker vom Jahrmarkt)
Autorin: Esther García Llovet
Verlag: Anagrama 2021, 152 Seiten
Gutachter: Luis Ruby
Kurzzusammenfassung
Der Komiker Castor lebt nach einem Lottogewinn auf 350 Quadratmetern im Madrider Nobelviertel Chamberí und hat keine Lust mehr, unter die Leute zu gehen. Da kommt ein Kellner gerade recht, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist und seiner Initiative wenig entgegenzusetzen hat. Allerdings ist plötzlich eine Chinesin hinter Castor her.
Über weite Strecken brillante, hochkomische Doppelgängergeschichte, die antiklimaktisch ausläuft.
Titel
Ein "Dicker vom Jahrmarkt" ist der Protagonist: eine Witzfigur, einer, um den es Gelächter gibt. Wobei er über weite Strecken nicht die Zielscheibe ist, sondern der Schütze.
Gordo de feria beschließt Esther García Llovets Trilogía instantánea de Madrid, die sie 2017 mit Cómo dejar de escribir (Wie man zu schreiben aufhört) begann und 2019 mit Sánchez fortsetzte [siehe mein Gutachten für New Spanish Books im selben Jahr]. Auch der abschließende Band trägt Züge eines alternativen Stadtromans, Momentaufnahmen (die "instantáneas" der Trilogie) mit unerwarteten Schauplätzen und nirgends richtig eingebundenen, aber interessant vernetzten Figuren.
Inhalt
Castor hat ein paar durchzechte Tage und Nächte hinter sich, als ein Unbekannter, der sich ihm als "die Hoffnung" vorstellt, ihm seine Brieftasche zurückgibt. Die gehört freilich nicht ihm, sondern einem gewissen Julio Céspedes, den er als Kellner am Arbeitsplatz ausfindig macht. Eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den beiden erklärt das mit der Brieftasche.
Castor erkennt schlagartig die Chance, lästige Pflichten auf seinen Doppelgänger auszulagern, und überrollt ihn mit diesem Ansinnen. Bald jedoch sieht er sich mit den bedrohlichen Nachstellungen einer rätselhaften Chinesin konfrontiert. Aus Julio ist dazu nichts herauszuholen.
Nach einigem Hin und Her setzt sich Julio nach Almería ab; Castor fällt der matronenhaft-dominanten Andalusierin Serafina in die Hände und wird von ihr in die Vorgeschichte eingeweiht.
Bis hierhin ist der kurze Roman neben seinen literarischen Qualitäten auch ein funktionierender Noir, der in verschiedene Richtungen aufgelöst werden könnte. Was aber nur sehr hopplahopp geschieht: Es kommt zu einer beiläufigen Heirat zwischen Castor und Serafina, deren weitere Biographie mit ein paar Pinselstrichen skizziert wird; Julio geht in der Rolle des bulimischen Komikers auf, der Humor und Horror mischt und damit die Chinesin und ihren Investorenvater inspiriert.
Dieses Ende ist so halbgar, wie es klingt, und eigentlich schon an der Struktur des Romans abzulesen: S. 7-116 "Ein Dicker" (Castor); S. 117-134 "Ein Dünner" (Julio); S. 135-152 "Un cuento chino" – was wörtlich "Eine chinesische Geschichte" heißt, idiomatisch aber auch "Ein Schmarren". Und an diesem Punkt fragt man sich, ob das Ende etwas anderes ist als (Selbst-?)Sabotage.
Davon abgesehen, gibt es an diesem Buch vieles zu loben, fast würde ich sagen: zu bejubeln, und das hängt vor allem zusammen mit
Sprache und Stil
"Castor ist ein unpolitischer Mensch, und seit er im Lotto gewonnen hat, erst recht."
García Llovets Stil ist pointiert-sarkastisch, knapp und rhythmisch, auf halbem Weg zum Stakkato. Die Sätze kurz, überwiegend im Präsens, manchmal ohne Verb, ohne dass solche Eigenheiten allzu sehr auffielen. Das sichere Timing betrifft oft Phrase und Plot zugleich.
Ein Beispiel: Castor erfährt von der Portiersfrau, dass Julio nach Almería gegangen sei, um sein Leben "um 360 Grad zu drehen". Die unfreiwillige Ironie der Formulierung rutscht einem fast durch, weil sich der Dialog in grotesk-treffender Weise um Castors Bemühen dreht, nicht mit "Señorito" angeredet zu werden. Dabei kann er sich den Namen seiner Gesprächspartnerin nicht merken, obwohl sie ihn ständig aus ihren Gesprächen mit Julio zitiert:
"'Hat er irgendwas dagelassen?' – 'Er hat mir fünfzig Euro Trinkgeld gegeben und gesagt: Viel Glück, Lucrecia.' – 'Sehr schön. Und einen Zettel oder Brief?' – 'Nein, Señorito.' – 'Danke, vielen Dank. Wie war noch Ihr Name?' – 'Ist nicht so wichtig. Keine Ursache. Señorito.'"
So wird immer wieder schlank Gesellschaftskritik aufgetragen. Zurück zu Phrase und Plot: Castor ruft seinen Produzenten an, sie müssten die Dreharbeiten unterbrechen, er liege mit Fieber im Bett, "mit 360 Grad. Dann steht er mit zwei linken Füßen auf."
So würde Wolf Haas schreiben, wenn seine Stadt Madrid wäre. Oder ein weniger barocker (und selbstverliebter) Montero Glez.
Auf offensichtlichere Weise zieht der Roman Komik aus Klischees (etwa die Chinesen betreffend, nichts für woke Zeitgeistliche, muss man auch sagen). Daneben frappiert die Originalität von Vergleichen, die so scharf beobachtet wirken wie die Szenen selbst – und ebenso mal sehr realistisch, mal nahezu surrealistisch, getrieben von merkwürdigen Zufällen oder Fügungen. Oder von der Fingerfertigkeit einer Taschenspielerin, die an die augenscheinlich geltenden Regeln nicht gebunden ist.
"[Castor] zupft an seiner Augenbraue, während er sich einen Kaffee macht, an einem ganz langen Haar, wie von einem Achtzigjährigen. Was liegt da auf der Kaffeemaschine? Ein Zuckerbriefchen. Ein Zuckerbriefchen aus dem Beverly." [= Stichwort für den nächsten Handlungsschritt]
Bewertung und Empfehlung
Für einen Großteil der Lektüre hat mir dieses Buch so viel Spaß gemacht wie schon lange nichts mehr aus Spanien. Ich musste häufig laut lachen, war verblüfft über sprachliche Wendungen oder solche des Plots. Und habe das Können von Esther García Llovet bewundert.
Wie schon in Sánchez lernt man Madrid von denkbar ungewohnten Seiten kennen, durch die Augen einer Flaneurin und Kennerin der Stadt. Und möchte am liebsten alle möglichen Leute mitnehmen, die das unbedingt auch sehen sollen.
Das Ende des Romans macht mich etwas ratlos. Interviews mit der Autorin entnehme ich, dass sie es durchaus so wollte, "einen kompletten Blödsinn, weil das zu der Geschichte passte, wie einer dieser schlechten Witze, die man irgendwie anfängt, und dann weiß nicht, wie aufhören"1.
Man erfährt auch, dass sie die Literatur offenbar nicht allzu ernst nimmt. Ihr Stil verrät eine andere Wahrheit, aber diese stimmt offenbar auch, und leider scheint sie ihr in Spanien niemand auszureden. Ich fürchte, das ist eine gute Methode, um ein Geheimtipp zu bleiben, a writers' writer und viel zu lange unübersetzt. Obwohl auch das solchen Spaß machen würde ... Vielleicht ist ihre Schreibe hip genug, um das mit dem Plot nicht so ernst zu nehmen?
Feature
Den Mann hielt es kaum auf dem Stuhl. Aus der Hüfte nahm er Schwung und reckte sich nach vorn, den linken Arm gerade durchgedrückt...
WEITER
Interview
Martina Streble ist Gründerin des noch jungen Verlags „Edition Helden“, der auf Kindercomics spezialisiert ist. Frau Streble, Sie haben im Jahr 2022 einen Verlag für Kindercomics...
WEITER
Suchen
Themenbereich

SOBRE NOSOTROS
Bienvenidos a Nuevos Libros en Español. Aquí te presentamos títulos españoles actuales por los que...